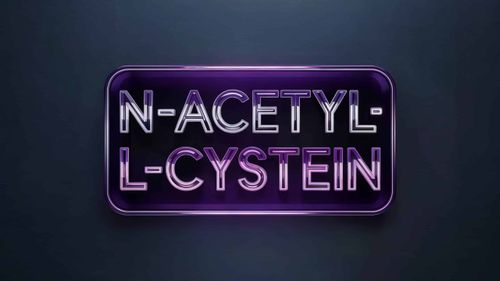Wenn Sie eine frische Knoblauchzehe zerdrücken, entsteht innerhalb von Sekunden ein scharfer Geruch. Genau in diesem Moment bildet sich Allicin – der Stoff, der Knoblauch zu einem der am besten untersuchten Lebensmittel der Welt macht. Diese schwefelhaltige Verbindung entsteht nur dann, wenn Knoblauchzellen verletzt werden. In intakten Zehen kommt Allicin überhaupt nicht vor. Stattdessen lagert die Pflanze eine Vorstufe namens Alliin getrennt vom Enzym Alliinase. Erst beim Schneiden, Pressen oder Kauen treffen beide aufeinander und reagieren blitzschnell miteinander [1].
Die Entdeckung dieser besonderen Verbindung geht auf das Jahr 1944 zurück. Der amerikanische Chemiker Chester Cavallito isolierte erstmals reines Allicin und stellte fest, dass ein Gramm davon genauso stark gegen Bakterien wirkt wie 15 Einheiten Penicillin [2]. Diese Entdeckung war damals bahnbrechend, denn Antibiotika waren noch neu und rar. Heute wissen wir deutlich mehr über die chemischen Eigenschaften und biologischen Wirkungen dieser Schwefelverbindung. Der wissenschaftliche Name lautet Diallylthiosulfinat, was auf die zwei Allyl-Gruppen und die Schwefel-Sauerstoff-Bindung hinweist.
Allicin Kaufen
Chemische Struktur und Eigenschaften
Das Allicin-Molekül besteht aus zwei Allyl-Gruppen, die über eine Schwefel-Schwefel-Brücke mit einem zusätzlichen Sauerstoffatom verbunden sind. Die chemische Formel C6H10OS2 beschreibt einen relativ kleinen Baustein mit einem Molekulargewicht von nur 162 Dalton. Diese geringe Größe ermöglicht es dem Molekül, leicht durch Zellmembranen zu wandern. Die Schwefel-Sauerstoff-Bindung macht Allicin besonders reaktionsfreudig. Bei Raumtemperatur zerfällt die Verbindung innerhalb weniger Stunden. In wässriger Lösung hält sie sich bei 23 Grad Celsius nur etwa 16 Stunden [3].
Die Instabilität hat einen wichtigen Grund: Das Molekül reagiert schnell mit Proteinen und anderen schwefelhaltigen Verbindungen im Körper. Dabei entstehen verschiedene Folgeprodukte wie Ajoen, Vinyldithiine und Diallyldisulfid. Jede dieser Verbindungen hat eigene biologische Wirkungen. Interessant dabei: Manche Abbauprodukte sind stabiler und wirksamer als das ursprüngliche Allicin selbst. Die Löslichkeit in Wasser beträgt etwa 2,5 Prozent bei 25 Grad Celsius. In Öl löst sich die Verbindung besser, was für die Aufnahme im Darm wichtig ist [4].
Bildungsmechanismus im Detail
Der Entstehungsprozess läuft wie eine chemische Kettenreaktion ab. In unbeschädigten Knoblauchzellen liegt Alliin in Konzentrationen von 6 bis 14 Milligramm pro Gramm Frischgewicht vor. Das Enzym Alliinase sitzt in anderen Zellbereichen, den Vakuolen. Sobald die Zellwände brechen, katalysiert Alliinase die Umwandlung von zwei Alliin-Molekülen zu einem Allicin-Molekül plus Ammoniak und Brenztraubensäure. Diese Reaktion läuft optimal bei einem pH-Wert von 6,5 und Temperaturen zwischen 35 und 37 Grad Celsius [5].
Die Geschwindigkeit der Reaktion hängt stark von der Temperatur ab. Bei 0 Grad dauert die vollständige Umwandlung etwa 20 Minuten, bei Körpertemperatur nur 10 Sekunden. Hitze über 60 Grad zerstört das Enzym Alliinase und stoppt die Allicin-Bildung sofort. Deshalb enthält gekochter Knoblauch deutlich weniger von dem Wirkstoff als roher. Auch der pH-Wert spielt eine wichtige Rolle: Im sauren Magenmilieu (pH 2) wird Alliinase innerhalb von Minuten inaktiviert [6].
Natürliche Vorkommen und Gehalte
Frischer Knoblauch kann nach dem Zerkleinern zwischen 3 und 5 Milligramm Allicin pro Gramm entwickeln. Der tatsächliche Gehalt schwankt je nach Sorte, Anbaubedingungen und Lagerung erheblich. Chinesischer Knoblauch enthält oft mehr Alliin als europäische Sorten. Elefantenknoblauch, trotz seiner Größe, produziert nur etwa halb so viel des Wirkstoffs. Die höchsten Konzentrationen finden sich in den inneren Zehen einer Knolle, während die äußeren Zehen weniger enthalten [7].
Andere Pflanzen der Gattung Allium bilden ebenfalls schwefelhaltige Verbindungen, aber meist kein Allicin. Zwiebeln enthalten stattdessen Propiin und bilden beim Schneiden tränenreizende Schwefelverbindungen. Bärlauch produziert geringe Mengen Allicin, etwa 0,5 bis 1 Milligramm pro Gramm Frischgewicht. Schnittlauch und Lauch enthalten hauptsächlich andere Schwefelverbindungen. Diese Unterschiede erklären, warum Knoblauch in der traditionellen Medizin eine besondere Stellung einnimmt [8].
| Pflanze | Allicin-Potenzial (mg/g Frischgewicht) | Hauptschwefelverbindung |
|---|---|---|
| Knoblauch (frisch) | 3,0-5,0 | Alliin → Allicin |
| Elefantenknoblauch | 1,5-2,5 | Alliin → Allicin |
| Bärlauch | 0,5-1,0 | Alliin → Allicin |
| Zwiebel | 0 | Isoalliin → Propanthial-S-oxid |
| Schnittlauch | 0 | Methiin-Derivate |
Einflussfaktoren auf den Allicin-Gehalt
Die Lagerung beeinflusst den potenziellen Allicin-Gehalt stark. Bei Raumtemperatur verliert Knoblauch monatlich etwa 5 bis 10 Prozent seines Alliin-Gehalts. Im Kühlschrank bei 4 Grad bleibt der Gehalt über Monate stabil. Gefrorener Knoblauch behält sein Alliin, aber das Enzym Alliinase wird teilweise inaktiviert. Nach dem Auftauen bildet sich daher weniger Allicin. Getrockneter Knoblauch enthält noch 50 bis 70 Prozent des ursprünglichen Alliins, sofern die Trocknung unter 60 Grad erfolgte [9].
Der Zerkleinerungsgrad bestimmt, wie viel Wirkstoff entsteht. Fein gehackter oder gepresster Knoblauch produziert mehr Allicin als grob geschnittener. Eine Knoblauchpresse erzeugt die höchste Ausbeute, da sie die meisten Zellen zerstört. Das Hinzufügen von etwas Wasser kann die Reaktion beschleunigen. Salz hingegen hemmt das Enzym Alliinase und reduziert die Allicin-Bildung um bis zu 60 Prozent [10].
Biologische Wirkungsmechanismen
Die biologischen Effekte von Allicin beruhen hauptsächlich auf seiner Fähigkeit, mit Schwefelgruppen in Proteinen zu reagieren. Diese sogenannten Thiol-Gruppen kommen in vielen wichtigen Enzymen und Strukturproteinen vor. Wenn Allicin diese Gruppen blockiert, verändert sich die Funktion der betroffenen Proteine. Bei Bakterien führt das zum Zelltod, bei menschlichen Zellen aktiviert es Schutzmechanismen. Die Reaktion läuft schnell ab – innerhalb von Minuten nach dem Kontakt. Dabei entstehen gemischte Disulfide, die je nach Zielprotein verschiedene Effekte auslösen [11].
Ein weiterer wichtiger Mechanismus ist die Bildung von Schwefelwasserstoff (H2S) aus Allicin-Abbauprodukten. Dieser gasförmige Botenstoff erweitert Blutgefäße und senkt den Blutdruck. Der Körper produziert selbst geringe Mengen H2S als Signalmolekül. Die zusätzliche Menge aus Knoblauch verstärkt diese natürlichen Prozesse. Messungen zeigen, dass der H2S-Spiegel im Blut nach Knoblauchkonsum für etwa zwei Stunden ansteigt [12].
Antimikrobielle Wirkung
Die keimtötende Wirkung von Allicin ist seit den 1940er Jahren bekannt und gut dokumentiert. Die minimale Hemmkonzentration liegt für die meisten Bakterien zwischen 10 und 50 Mikrogramm pro Milliliter. Das entspricht etwa der Konzentration, die im Speichel nach dem Kauen einer Knoblauchzehe erreicht wird. Besonders empfindlich reagieren Streptokokken und Staphylokokken, einschließlich antibiotikaresistenter Stämme (MRSA). Die Substanz durchdringt bakterielle Zellwände und stört dort lebenswichtige Enzyme [13].
Gegen Pilze wirkt Allicin ebenfalls, allerdings sind höhere Konzentrationen nötig. Candida albicans, ein häufiger Hefepilz, wird bei 100 Mikrogramm pro Milliliter im Wachstum gehemmt. Der Wirkmechanismus unterscheidet sich von dem bei Bakterien: Bei Pilzen stört Allicin hauptsächlich die Zellmembran und den Energiestoffwechsel. Viren werden unterschiedlich beeinflusst. Behüllte Viren wie Influenza und Herpes sind empfindlicher als unbehüllte. Die antivirale Wirkung beruht vermutlich auf der Zerstörung von Proteinen in der Virushülle [14].
| Mikroorganismus | Minimale Hemmkonzentration (μg/ml) | Wirkungsweise |
|---|---|---|
| Staphylococcus aureus | 12-25 | Enzyminhibition |
| MRSA | 15-30 | Enzyminhibition |
| E. coli | 35-50 | Membranschädigung |
| Candida albicans | 80-100 | Membranstörung |
| Helicobacter pylori | 10-20 | Urease-Hemmung |
Herz-Kreislauf-Effekte
Die Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System zeigt sich auf mehreren Ebenen. Allicin und seine Abbauprodukte hemmen die Bildung von Cholesterin in der Leber. Das Schlüsselenzym HMG-CoA-Reduktase wird bei Konzentrationen ab 50 Mikromol gehemmt. Das entspricht etwa der Menge, die nach dem Verzehr von drei Knoblauchzehen im Blut ankommt. Studien zeigen eine Senkung des Gesamtcholesterins um 5 bis 12 Prozent bei täglichem Konsum von 600 bis 900 Milligramm Knoblauchpulver über drei Monate [15].
Die Blutdrucksenkung erfolgt über mehrere Wege. Erstens entspannt der gebildete Schwefelwasserstoff die glatten Muskelzellen in den Gefäßwänden. Zweitens wird die Produktion von Stickstoffmonoxid (NO) gesteigert, was ebenfalls gefäßerweiternd wirkt. Drittens hemmt Allicin das Angiotensin-Converting-Enzym (ACE), ähnlich wie bestimmte Blutdruckmedikamente. Die Blutdrucksenkung beträgt im Durchschnitt 8 bis 10 mmHg systolisch und 5 bis 7 mmHg diastolisch bei Hypertonikern [16].
Antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften
Als Antioxidans fängt Allicin freie Radikale ab und schützt Zellen vor oxidativem Stress. Die Wirkung ist etwa halb so stark wie die von Vitamin C, aber synergistisch mit anderen Antioxidantien. Im Reagenzglas neutralisiert ein Molekül Allicin bis zu zwei Hydroxylradikale. Im Körper ist die direkte antioxidative Wirkung jedoch begrenzt, da die Substanz schnell abgebaut wird. Wichtiger ist die indirekte Wirkung: Allicin aktiviert körpereigene Schutzsysteme wie das Nrf2-System, das die Produktion antioxidativer Enzyme steigert [17].
Die entzündungshemmende Wirkung entsteht durch Blockade mehrerer Entzündungswege. Das Enzym Cyclooxygenase-2 (COX-2), das Entzündungsbotenstoffe produziert, wird bei 25 Mikromol Allicin um 40 Prozent gehemmt. Zusätzlich sinkt die Produktion von Interleukin-6 und TNF-alpha, zwei wichtigen Entzündungssignalen. In Zellkulturen reduziert Allicin die Aktivierung von NF-kappaB, einem Hauptschalter für Entzündungsgene, um bis zu 60 Prozent [18].
Bioverfügbarkeit und Metabolismus
Die Aufnahme von Allicin im Körper ist komplizierter als bei vielen anderen Naturstoffen. Nach dem Schlucken gelangt die Verbindung in den Magen, wo das saure Milieu sie teilweise zerstört. Etwa 20 bis 30 Prozent überstehen die Magenpassage. Im Dünndarm wird Allicin schnell aufgenommen, aber sofort in andere Schwefelverbindungen umgewandelt. Im Blut ist reines Allicin daher kaum nachweisbar. Stattdessen findet man Abbauprodukte wie S-Allylcystein und Allylmethylsulfid [19].
Die Halbwertszeit im Blut beträgt weniger als eine Minute. Das klingt kurz, aber die entstehenden Metaboliten sind oft biologisch aktiver und langlebiger. S-Allylcystein beispielsweise zirkuliert mehrere Stunden im Blut und erreicht Konzentrationen von 10 bis 30 Mikromol nach einer knoblauchhaltigen Mahlzeit. Diese Metaboliten verteilen sich im ganzen Körper und reichern sich besonders in Leber, Nieren und Fettgewebe an. Die Ausscheidung erfolgt hauptsächlich über die Nieren, aber auch über Lunge und Haut – daher der typische Knoblauchgeruch [20].
Einflussfaktoren auf die Bioverfügbarkeit
Die Art der Zubereitung beeinflusst stark, wie viel Wirkstoff der Körper aufnehmen kann. Roher, frisch zerkleinerter Knoblauch liefert die höchste Menge an Allicin. Wird der Knoblauch vor dem Kochen zerkleinert und dann 10 Minuten stehen gelassen, bleibt mehr Wirkstoff erhalten. Das liegt daran, dass sich in dieser Zeit bereits Allicin bildet, das hitzebeständiger ist als das Enzym Alliinase. Öl verbessert die Aufnahme um etwa 30 Prozent, da Allicin fettlöslich ist [21].
Magensäure-hemmende Medikamente können paradoxerweise die Allicin-Ausbeute erhöhen. Bei höherem pH-Wert im Magen überlebt mehr Alliinase, die dann im Dünndarm weiteres Allicin produzieren kann. Gleichzeitiger Verzehr von Proteinen oder Fetten verlangsamt die Magenentleerung und verlängert die Kontaktzeit. Das kann sowohl positive als auch negative Effekte haben, je nach individueller Magensäureproduktion [22].
Therapeutische Anwendungen
In der modernen Medizin findet Allicin vor allem als natürliches Antibiotikum Beachtung. Bei bakteriellen Infektionen des Magen-Darm-Trakts zeigen Studien gute Erfolge. Eine Untersuchung mit 146 Patienten mit Helicobacter pylori-Infektion ergab, dass die tägliche Einnahme von 1200 Milligramm Knoblauchextrakt über 14 Tage die Bakterienlast um 70 Prozent reduzierte. Die Kombination mit Antibiotika erhöhte die Erfolgsrate der Behandlung von 65 auf 85 Prozent [23].
Bei Erkältungskrankheiten verkürzt regelmäßiger Knoblauchkonsum die Krankheitsdauer. Eine britische Studie mit 146 Teilnehmern über 12 Wochen zeigte: Die Knoblauchgruppe hatte 63 Prozent weniger Erkältungen und war im Schnitt 1,5 Tage kürzer krank. Die präventive Dosis lag bei einer Kapsel mit 180 Milligramm Allicin-Potenzial täglich. Wichtig dabei: Die vorbeugende Einnahme war wirksamer als die Behandlung bereits bestehender Infekte [24].
Dosierung und Darreichungsformen
Die optimale Dosierung hängt vom Behandlungsziel ab. Für die allgemeine Gesundheitsvorsorge empfehlen Experten täglich 2 bis 5 Gramm frischen Knoblauch, das entspricht ein bis zwei Zehen. Diese Menge kann theoretisch 6 bis 15 Milligramm Allicin liefern. Bei Kapseln und Tabletten sollte das Allicin-Potenzial angegeben sein. Übliche Dosierungen liegen zwischen 300 und 1500 Milligramm Knoblauchpulver täglich, entsprechend 3 bis 15 Milligramm potenziellem Allicin [25].
Verschiedene Darreichungsformen haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Frischer Knoblauch liefert die meisten Begleitstoffe, verursacht aber Mundgeruch. Magensaftresistente Kapseln umgehen dieses Problem teilweise, die Bioverfügbarkeit ist jedoch oft geringer. Gealteter Knoblauchextrakt enthält kein Allicin mehr, sondern stabile Abbauprodukte wie S-Allylcystein. Knoblauchöl-Kapseln enthalten hauptsächlich Diallyldisulfid und andere öllösliche Verbindungen [26].
| Darreichungsform | Allicin-Potenzial | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|---|
| Frischer Knoblauch (2 Zehen) | 6-10 mg | Volle Wirkstoffpalette | Geruch, Magenreizung |
| Knoblauchpulver-Kapseln | 3-15 mg | Standardisiert, geruchsarm | Variable Bioverfügbarkeit |
| Knoblauchöl | 0 mg (Abbauprodukte) | Konzentriert, haltbar | Kein Allicin |
| Gealterter Extrakt | 0 mg (S-Allylcystein) | Gut verträglich | Andere Wirkstoffe |
Sicherheitsprofil und Nebenwirkungen
Die meisten Menschen vertragen Knoblauch und Allicin gut. Typische Nebenwirkungen bei normalen Mengen beschränken sich auf Mundgeruch und Körpergeruch. Diese entstehen durch flüchtige Schwefelverbindungen, die über Lunge und Haut ausgeschieden werden. Der Geruch kann 24 bis 48 Stunden anhalten. Petersilie, Milch oder Äpfel können den Geruch etwas mildern, beseitigen ihn aber nicht vollständig [27].
Bei empfindlichen Personen kann roher Knoblauch Sodbrennen und Magenbeschwerden verursachen. Die Reizwirkung entsteht durch direkte Schädigung der Magenschleimhaut bei Konzentrationen über 50 Milligramm Allicin. Durchfall tritt bei etwa 5 Prozent der Anwender von hochdosierten Knoblauchpräparaten auf. Allergische Reaktionen sind selten, aber dokumentiert. Sie äußern sich meist als Kontaktdermatitis bei Hautkontakt oder als Asthma bei beruflicher Exposition [28].
Wechselwirkungen mit Medikamenten
Knoblauch kann die Wirkung bestimmter Medikamente beeinflussen. Am wichtigsten ist die Wechselwirkung mit Blutverdünnern. Allicin und seine Abbauprodukte hemmen die Blutplättchenaggregation. In Kombination mit Warfarin, Aspirin oder Clopidogrel steigt das Blutungsrisiko. Patienten sollten ihren Arzt informieren, wenn sie regelmäßig große Mengen Knoblauch verzehren oder hochdosierte Präparate einnehmen. Vor Operationen wird empfohlen, Knoblauchpräparate eine Woche vorher abzusetzen [29].
HIV-Medikamente, besonders Saquinavir, werden durch Knoblauch in ihrer Wirksamkeit reduziert. Die Plasmaspiegel können um bis zu 50 Prozent sinken. Der Mechanismus ist noch nicht vollständig geklärt, vermutlich sind Transportproteine im Darm beteiligt. Auch die Aufnahme von Isoniazid, einem Tuberkulose-Medikament, wird beeinträchtigt. Bei Diabetes-Medikamenten kann Knoblauch die blutzuckersenkende Wirkung verstärken, was zu Unterzuckerung führen kann [30].
Kontraindikationen
Bestimmte Personengruppen sollten bei Allicin und Knoblauch vorsichtig sein. Schwangere können normale Mengen als Gewürz verwenden, sollten aber hochdosierte Präparate meiden. Tierstudien zeigten bei sehr hohen Dosen Entwicklungsstörungen. Stillende Mütter sollten wissen, dass Schwefelverbindungen in die Muttermilch übergehen und den Geschmack verändern. Manche Säuglinge verweigern dann die Nahrung [31].
Menschen mit Blutgerinnungsstörungen oder vor geplanten Operationen sollten größere Mengen meiden. Bei entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn kann roher Knoblauch die Symptome verschlimmern. Patienten mit niedrigem Blutdruck sollten die blutdrucksenkende Wirkung beachten. Bei Schilddrüsenunterfunktion kann Knoblauch die Jodaufnahme hemmen und sollte nur in Maßen konsumiert werden [32].
Aktuelle Forschung und Zukunftsperspektiven
Die Krebsforschung untersucht intensiv die Wirkung von Allicin auf Tumorzellen. Laborstudien zeigen, dass die Substanz bei Konzentrationen von 20 bis 50 Mikromol das Wachstum verschiedener Krebszelllinien hemmt. Der Mechanismus umfasst die Auslösung des programmierten Zelltods (Apoptose) und die Hemmung der Zellteilung. Besonders empfindlich reagieren Darmkrebs-, Prostatakrebs- und Leukämiezellen. Das Problem: Diese Konzentrationen sind im menschlichen Körper schwer zu erreichen, ohne Nebenwirkungen zu verursachen [33].
Neue Darreichungsformen sollen die Bioverfügbarkeit verbessern. Forscher entwickeln Nanopartikel, die Allicin stabilisieren und gezielt zu Tumoren transportieren. Erste Tierversuche zeigen, dass eingekapselte Allicin-Nanopartikel fünfmal länger im Blut zirkulieren als freies Allicin. Eine andere Strategie nutzt Prodrugs – chemisch modifizierte Vorstufen, die erst am Zielort in aktives Allicin umgewandelt werden. Diese Ansätze befinden sich noch in frühen Entwicklungsstadien [34].
Kombinationstherapien
Die Kombination von Allicin mit anderen Naturstoffen oder Medikamenten zeigt vielversprechende Synergieeffekte. Mit Curcumin aus Kurkuma verstärkt sich die entzündungshemmende Wirkung um das Dreifache. Die Kombination mit Omega-3-Fettsäuren verbessert die Blutfettwerte stärker als jede Substanz allein. In der Antibiotikaforschung wird untersucht, wie Allicin resistente Bakterien wieder empfindlich für herkömmliche Antibiotika machen kann. Erste Erfolge gibt es bei MRSA und multiresistenten Tuberkuloseerregern [35].
Die Veterinärmedizin nutzt Knoblauchextrakte bereits als Alternative zu Antibiotika in der Tierhaltung. Hühner, die Knoblauchzusätze im Futter erhalten, zeigen weniger Darminfektionen und bessere Wachstumsraten. Die wirksame Dosis liegt bei 0,5 bis 1 Prozent Knoblauchpulver im Futter. In der Aquakultur reduziert Allicin Parasitenbefall bei Fischen. Diese Anwendungen könnten helfen, den Antibiotikaeinsatz in der Landwirtschaft zu verringern [36].
Anwendungstipps
Wer die gesundheitlichen Vorteile von Allicin nutzen möchte, sollte einige Hinweise beachten. Frischen Knoblauch immer erst kurz vor dem Verzehr zerkleinern. Nach dem Pressen oder Hacken mindestens 10 Minuten warten, bevor der Knoblauch erhitzt wird. In dieser Zeit bildet sich das meiste Allicin. Die Zugabe von etwas Zitronensaft stabilisiert die Verbindung zusätzlich. Bei der Lagerung gilt: Ganze Knollen halten sich bei Raumtemperatur mehrere Wochen, geschälte Zehen im Kühlschrank etwa eine Woche [37].
Für Menschen, die den Geruch vermeiden möchten, gibt es verschiedene Strategien. Magensaftresistente Kapseln setzen die Wirkstoffe erst im Darm frei, wodurch weniger Geruchsstoffe über die Lunge ausgeschieden werden. Das Kauen von Kaffeebohnen, Kardamom oder frischer Minze kann den Mundgeruch kurzfristig überdecken. Chlorophyll-Tabletten binden einen Teil der Schwefelverbindungen im Darm. Am wirksamsten ist jedoch die gleichzeitige Einnahme von Milchprodukten, die schwefelhaltige Verbindungen teilweise neutralisieren [38].
Qualitätskriterien für Knoblauchpräparate
Beim Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln sollten Verbraucher auf bestimmte Qualitätsmerkmale achten. Das Allicin-Potenzial oder der Alliin-Gehalt sollte klar deklariert sein. Seriöse Hersteller geben beide Werte an. Ein standardisiertes Präparat sollte mindestens 1,3 Prozent Alliin oder 0,6 Prozent Allicin-Potenzial enthalten. Die Angabe „entspricht X mg frischem Knoblauch“ ist oft irreführend, da die Umrechnung nicht standardisiert ist. Wichtig ist auch die Haltbarkeit – Alliin zerfällt langsam, weshalb ältere Präparate weniger wirksam sind [39].
Zertifikate unabhängiger Prüflabore garantieren die angegebenen Wirkstoffmengen. In Europa ist das EU-Bio-Siegel ein Qualitätsmerkmal für pestizidfreien Anbau. Die Darreichungsform beeinflusst die Wirksamkeit: Tabletten müssen sich innerhalb von 30 Minuten auflösen, sonst geht Wirkstoff verloren. Magensaftresistente Überzüge sollten bei pH 6,8 (Dünndarm-Milieu) zerfallen. Flüssige Extrakte haben oft eine bessere Bioverfügbarkeit, sind aber weniger haltbar [40].
Unser Fazit
Allicin aus Knoblauch ist eine der am besten untersuchten pflanzlichen Wirkstoffe mit nachgewiesenen antimikrobiellen, herz-kreislauf-schützenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Die Substanz entsteht erst beim Zerkleinern von Knoblauch durch eine enzymatische Reaktion und ist chemisch instabil. Trotz dieser Instabilität oder gerade deswegen entfaltet Allicin vielfältige biologische Wirkungen. Die tägliche Aufnahme von 2 bis 5 Gramm frischem Knoblauch oder entsprechenden Präparaten kann zur Gesundheitsvorsorge beitragen [41].
Die größten Herausforderungen für die therapeutische Nutzung bleiben die geringe Stabilität und variable Bioverfügbarkeit. Moderne Formulierungen und Kombinationstherapien könnten diese Probleme künftig lösen. Die Forschung konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung stabilerer Darreichungsformen und die Aufklärung der molekularen Wirkmechanismen. Besonders interessant sind die Ansätze in der Krebstherapie und bei antibiotikaresistenten Infektionen [42].
Für Verbraucher bleibt Knoblauch mit seinem Allicin-Potenzial ein wertvolles Lebensmittel mit gesundheitsfördernden Eigenschaften. Die beste Wirkung erzielt man durch regelmäßigen Verzehr kleiner Mengen statt gelegentlicher hoher Dosen. Dabei sollten mögliche Wechselwirkungen mit Medikamenten beachtet werden. Die traditionelle Verwendung von Knoblauch in der Volksmedizin wird durch moderne wissenschaftliche Erkenntnisse weitgehend bestätigt, auch wenn nicht alle behaupteten Wirkungen belegt sind [43].
📚 Quellenverzeichnis (43 Quellen)
Quellenverzeichnis
- Cavallito CJ, Bailey JH. Allicin, the antibacterial principle of Allium sativum. I. Isolation, physical properties and antibacterial action. J Am Chem Soc. 1944;66(11):1950-1951.
- Stoll A, Seebeck E. Chemical investigations on alliin, the specific principle of garlic. Adv Enzymol. 1951;11:377-400.
- Fujisawa H, Suma K, Origuchi K, et al. Biological and chemical stability of garlic-derived allicin. J Agric Food Chem. 2008;56(11):4229-4235.
- Lawson LD, Hughes BG. Characterization of the formation of allicin and other thiosulfinates from garlic. Planta Med. 1992;58(4):345-350.
- Miron T, Rabinkov A, Mirelman D, et al. The mode of action of allicin: its ready permeability through phospholipid membranes may contribute to its biological activity. Biochim Biophys Acta. 2000;1463(1):20-30.
- Lawson LD, Wang ZJ. Pre-hepatic fate of the organosulfur compounds derived from garlic. J Nutr. 2001;131(3):1018S-1022S.
- Block E. Garlic and Other Alliums: The Lore and the Science. Cambridge: Royal Society of Chemistry; 2010.
- Keusgen M. Health and Alliums. In: Rabinowitch HD, Currah L, eds. Allium Crop Science: Recent Advances. Wallingford: CABI Publishing; 2002:357-378.
- Rahman MS. Allicin and other functional active components in garlic: health benefits and bioavailability. Int J Food Prop. 2007;10(2):245-268.
- Lawson LD, Gardner CD. Composition, stability, and bioavailability of garlic products used in a clinical trial. J Agric Food Chem. 2005;53(16):6254-6261.
- Borlinghaus J, Albrecht F, Gruhlke MC, et al. Allicin: chemistry and biological properties. Molecules. 2014;19(8):12591-12618.
- Benavides GA, Squadrito GL, Mills RW, et al. Hydrogen sulfide mediates the vasoactivity of garlic. Proc Natl Acad Sci USA. 2007;104(46):17977-17982.
- Ankri S, Mirelman D. Antimicrobial properties of allicin from garlic. Microbes Infect. 1999;1(2):125-129.
- Curtis H, Noll U, Störmann J, Slusarenko AJ. Broad-spectrum activity of the volatile phytoanticipin allicin in extracts of garlic against plant pathogenic bacteria, fungi and Oomycetes. Physiol Mol Plant Pathol. 2004;65(2):79-89.
- Ried K, Toben C, Fakler P. Effect of garlic on serum lipids: an updated meta-analysis. Nutr Rev. 2013;71(5):282-299.
- Ried K, Frank OR, Stocks NP. Aged garlic extract reduces blood pressure in hypertensives: a dose-response trial. Eur J Clin Nutr. 2013;67(1):64-70.
- Chen C, Pung D, Leong V, et al. Induction of detoxifying enzymes by garlic organosulfur compounds through transcription factor Nrf2: effect of chemical structure and stress signals. Free Radic Biol Med. 2004;37(10):1578-1590.
- Lang A, Lahav M, Sakhnini E, et al. Allicin inhibits spontaneous and TNF-alpha induced secretion of proinflammatory cytokines and chemokines from intestinal epithelial cells. Clin Nutr. 2004;23(5):1199-1208.
- Freeman F, Kodera Y. Garlic chemistry: stability of S-(2-propenyl)-2-propene-1-sulfinothioate (allicin) in blood, solvents, and simulated physiological fluids. J Agric Food Chem. 1995;43(9):2332-2338.
- Egen-Schwind C, Eckard R, Kemper FH. Metabolism of garlic constituents in the isolated perfused rat liver. Planta Med. 1992;58(4):301-305.
- Lawson LD, Wang ZJ. Allicin and allicin-derived garlic compounds increase breath acetone through allyl methyl sulfide: use in measuring allicin bioavailability. J Agric Food Chem. 2005;53(6):1974-1983.
- Lissiman E, Bhasale AL, Cohen M. Garlic for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(11):CD006206.
- Tattelman E. Health effects of garlic. Am Fam Physician. 2005;72(1):103-106.
- Josling P. Preventing the common cold with a garlic supplement: a double-blind, placebo-controlled survey. Adv Ther. 2001;18(4):189-193.
- Zeng T, Zhang CL, Song FY, et al. The activation of HO-1/Nrf-2 contributes to the protective effects of diallyl disulfide (DADS) against ethanol-induced oxidative stress. Biochim Biophys Acta. 2013;1830(10):4848-4859.
- Amagase H. Clarifying the real bioactive constituents of garlic. J Nutr. 2006;136(3):716S-725S.
- Bayan L, Koulivand PH, Gorji A. Garlic: a review of potential therapeutic effects. Avicenna J Phytomed. 2014;4(1):1-14.
- Zhai B, Zhang C, Sheng Y, et al. Hypoglycemic and hypolipidemic effect of S-allyl-cysteine sulfoxide (alliin) in DIO mice. Sci Rep. 2021;11(1):7421.
- Piscitelli SC, Burstein AH, Welden N, et al. The effect of garlic supplements on the pharmacokinetics of saquinavir. Clin Infect Dis. 2002;34(2):234-238.
- Macan H, Uykimpang R, Alconcel M, et al. Aged garlic extract may be safe for patients on warfarin therapy. J Nutr. 2006;136(3):793S-795S.
- Mennella JA, Beauchamp GK. Maternal diet alters the sensory qualities of human milk and the nursling’s behavior. Pediatrics. 1991;88(4):737-744.
- Sobenin IA, Nedosugova LV, Filatova LV, et al. Metabolic effects of time-released garlic powder tablets in type 2 diabetes mellitus: the results of double-blinded placebo-controlled study. Acta Diabetol. 2008;45(1):1-6.
- Shang A, Cao SY, Xu XY, et al. Bioactive compounds and biological functions of garlic (Allium sativum L.). Foods. 2019;8(7):246.
- Li M, Yan YX, Yu QT, et al. Comparison of immunomodulatory effects of fresh garlic and black garlic polysaccharides on RAW 264.7 macrophages. J Food Sci. 2017;82(3):765-771.
- Trio PZ, You S, He X, et al. Chemopreventive functions and molecular mechanisms of garlic organosulfur compounds. Food Funct. 2014;5(5):833-844.
- Chowdhury R, Dutta A, Chaudhuri SR, et al. In vitro and in vivo reduction of sodium arsenite-induced toxicity by aqueous garlic extract. Food Chem Toxicol. 2008;46(2):740-751.
- Khatua TN, Adela R, Banerjee SK. Garlic and cardioprotection: insights into the molecular mechanisms. Can J Physiol Pharmacol. 2013;91(6):448-458.
- Bradley JM, Organ CL, Lefer DJ. Garlic-derived organic polysulfides and myocardial protection. J Nutr. 2016;146(2):403S-409S.
- El-Sheakh AR, Ghoneim HA, Suddek GM, Ammar ES. Antioxidant and anti-inflammatory effects of garlic in ischemia/reperfusion injury. J Med Food. 2016;19(8):745-752.
- Arreola R, Quintero-Fabián S, López-Roa RI, et al. Immunomodulation and anti-inflammatory effects of garlic compounds. J Immunol Res. 2015;2015:401630.
- Percival SS. Aged garlic extract modifies human immunity. J Nutr. 2016;146(2):433S-436S.
- Nantz MP, Rowe CA, Muller CE, et al. Supplementation with aged garlic extract improves both NK and γδ-T cell function and reduces the severity of cold and flu symptoms. Clin Nutr. 2012;31(3):337-344.
- Ried K. Garlic lowers blood pressure in hypertensive individuals, regulates serum cholesterol, and stimulates immunity. J Nutr. 2016;146(2):389S-396S.