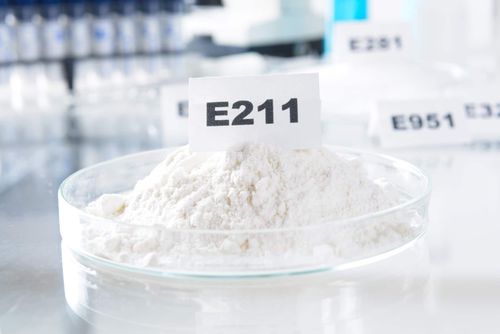In fast jedem Wurstprodukt findet sich eine Substanz, die seit Jahrzehnten heftig diskutiert wird: Natriumnitrit. Diese chemische Verbindung mit der Formel NaNO₂ erfüllt in der Lebensmittelindustrie gleich mehrere Aufgaben - sie konserviert, verleiht die typische rote Farbe und schützt vor gefährlichen Bakterien. Gleichzeitig steht sie im Verdacht, krebserregend zu sein. Was steckt wirklich hinter diesem Stoff, der in Deutschland als E 250 auf Zutatenlisten auftaucht? Dieser Artikel betrachtet die wissenschaftlichen Fakten ohne Beschönigung und erklärt, was Verbraucher über Natriumnitrit wissen sollten.
Die Verwendung von Nitritsalzen zur Haltbarmachung von Fleisch hat eine lange Geschichte. Bereits im Mittelalter entdeckten Menschen zufällig, dass bestimmte Salze Fleisch nicht nur haltbar machen, sondern ihm auch eine appetitliche rote Farbe verleihen. Heute wissen wir, dass diese Salze Nitrit enthielten. In der modernen Lebensmittelproduktion gehört Natriumnitrit zu den am häufigsten eingesetzten Zusatzstoffen in Fleischprodukten. Die Substanz erfüllt dabei mehrere wichtige Funktionen gleichzeitig, birgt aber auch Risiken, die genau verstanden werden müssen.
Chemische Eigenschaften und Grundlagen
Natriumnitrit ist das Natriumsalz der salpetrigen Säure. Als weißes bis leicht gelbliches Pulver löst es sich sehr gut in Wasser und bildet dabei eine alkalische Lösung. Die Verbindung ist bei Raumtemperatur stabil, kann aber unter bestimmten Bedingungen - etwa bei hohen Temperaturen oder in saurer Umgebung - zu verschiedenen Reaktionsprodukten umgewandelt werden. Diese chemischen Eigenschaften sind sowohl für die erwünschten als auch für die problematischen Wirkungen von Natriumnitrit verantwortlich.
Im Gegensatz zu Natriumnitrat (NaNO₃), das ebenfalls als Konservierungsmittel verwendet wird, wirkt Nitrit direkt und muss nicht erst durch Bakterien umgewandelt werden. Ein Nitrit-Ion (NO₂⁻) enthält ein Stickstoffatom und zwei Sauerstoffatome. Diese Struktur macht es zu einem reaktiven Molekül, das leicht mit anderen Verbindungen reagiert. Besonders wichtig ist die Fähigkeit von Nitrit, Stickstoffmonoxid (NO) zu bilden - ein Gas, das für viele biologische Wirkungen verantwortlich ist [1].
Die Reaktivität von Nitrit hängt stark vom pH-Wert ab. In saurer Umgebung, wie sie im Magen herrscht (pH 1-3), wird aus Nitrit salpetrige Säure gebildet. Diese kann weiter zu verschiedenen Stickstoffverbindungen reagieren, darunter auch zu den problematischen Nitrosaminen. Bei neutralem pH-Wert, wie er in den meisten Lebensmitteln vorliegt, bleibt Nitrit stabiler. Diese pH-Abhängigkeit spielt eine wichtige Rolle für das Verständnis der gesundheitlichen Auswirkungen [2].
Unterschied zwischen Nitrit und Nitrat
Obwohl die Namen ähnlich klingen, unterscheiden sich Nitrit und Nitrat deutlich in ihrer chemischen Struktur und Wirkung. Nitrat (NO₃⁻) enthält ein Sauerstoffatom mehr als Nitrit und ist deutlich weniger reaktiv. In Lebensmitteln kann Nitrat durch bestimmte Bakterien zu Nitrit reduziert werden - ein Prozess, der sowohl im Lebensmittel direkt als auch im menschlichen Körper abläuft. Etwa 5 bis 7 Prozent des aufgenommenen Nitrats werden im Speichel zu Nitrit umgewandelt [3].
Während Nitrat hauptsächlich über Gemüse aufgenommen wird und in normalen Mengen als unbedenklich gilt, wirkt Nitrit direkter und in niedrigeren Konzentrationen. Die tägliche Aufnahme von Nitrat liegt bei durchschnittlich 50 bis 150 mg, wobei der Großteil aus Gemüse wie Spinat, Rucola oder Rote Bete stammt. Die Nitritaufnahme beträgt dagegen nur etwa 1 bis 3 mg täglich, hauptsächlich aus verarbeiteten Fleischprodukten [4].
Verwendung in der Lebensmittelindustrie
Die Lebensmittelindustrie setzt Natriumnitrit aus drei Hauptgründen ein: Konservierung, Farberhaltung und Geschmacksbildung. Jede dieser Funktionen beruht auf spezifischen chemischen Reaktionen, die das Nitrit-Ion mit verschiedenen Bestandteilen des Lebensmittels eingeht. Tatsächlich ist Nitrit einer der wenigen Zusatzstoffe, der gleich mehrere technologische Funktionen in einem erfüllt - was erklärt, warum die Industrie trotz gesundheitlicher Bedenken nur schwer darauf verzichten kann.
In der EU ist die Verwendung von Natriumnitrit streng reguliert. Die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 legt fest, in welchen Lebensmitteln wie viel Nitrit enthalten sein darf. Die Höchstmengen liegen je nach Produkt zwischen 100 und 175 mg pro Kilogramm. Traditionell hergestellte Produkte dürfen unter bestimmten Bedingungen höhere Mengen enthalten. Diese Grenzwerte basieren auf einem Kompromiss zwischen dem notwendigen Schutz vor bakterieller Kontamination und der Minimierung gesundheitlicher Risiken [5].
Die tatsächlich eingesetzten Mengen liegen oft deutlich unter den erlaubten Höchstwerten. Moderne Produktionsverfahren ermöglichen es, mit 50 bis 80 mg Nitrit pro Kilogramm auszukommen und trotzdem eine ausreichende Konservierung zu erreichen. Dabei wird Nitrit meist nicht als Reinstoff, sondern als Nitritpökelsalz eingesetzt - eine Mischung aus Kochsalz und 0,4 bis 0,5 Prozent Natriumnitrit. Diese Verdünnung reduziert das Risiko von Überdosierungen bei der Herstellung [6].
Konservierende Wirkung
Die wichtigste Funktion von Nitrit ist der Schutz vor Clostridium botulinum, dem Erreger des Botulismus. Diese Bakterien produzieren eines der stärksten bekannten Gifte - schon wenige Mikrogramm können tödlich sein. Nitrit hemmt das Wachstum dieser Bakterien und verhindert die Bildung ihrer widerstandsfähigen Sporen. Der genaue Mechanismus ist komplex: Nitrit stört verschiedene Enzyme im Stoffwechsel der Bakterien, besonders die Eisenschwefelproteine, die für die Energiegewinnung wichtig sind [7].
Die Wirkung gegen Clostridien hängt von mehreren Faktoren ab. Neben der Nitritkonzentration spielen der pH-Wert, der Salzgehalt, die Lagertemperatur und die Anwesenheit anderer Konservierungsstoffe eine Rolle. Bei einem pH-Wert unter 5,5 und einer Temperatur unter 10°C reichen bereits 40 mg Nitrit pro Kilogramm aus, um Clostridien zuverlässig zu hemmen. Bei höheren pH-Werten oder Temperaturen werden 80 bis 120 mg benötigt. Diese Wechselwirkungen nutzt die Industrie, um die Nitritmenge zu optimieren [8].
Neben Clostridien hemmt Nitrit auch andere unerwünschte Bakterien wie Listerien, Salmonellen und bestimmte Verderbniserreger. Die Wirkung ist allerdings weniger ausgeprägt als bei Clostridien. Für diese Keime sind meist höhere Konzentrationen nötig, weshalb zusätzliche Konservierungsmaßnahmen wie Kühlung, Vakuumverpackung oder der Zusatz von organischen Säuren eingesetzt werden [9].
Farbgebung und Umrötung
Die appetitliche rote Farbe von Schinken, Salami und anderen Pökelprodukten entsteht durch eine Reaktion zwischen Nitrit und dem Muskelfarbstoff Myoglobin. Ohne Nitrit würde erhitztes Fleisch graubraun aussehen - wie ein normaler Braten. Die Umrötung läuft in mehreren Schritten ab: Zuerst wird Nitrit zu Stickstoffmonoxid (NO) reduziert. Dieses bindet dann an das Eisenatom im Myoglobin und bildet Nitrosomyoglobin. Beim Erhitzen entsteht daraus das stabile, hitzebeständige Nitrosomyochromogen, das die charakteristische rote Farbe zeigt [10].
Die Farbbildung benötigt nur geringe Mengen Nitrit - etwa 20 bis 30 mg pro Kilogramm reichen aus. Allerdings muss genügend Nitrit vorhanden sein, um die Farbe während der gesamten Lagerzeit stabil zu halten. Licht, Sauerstoff und bestimmte Bakterien können die rote Farbe zerstören, weshalb in der Praxis höhere Mengen eingesetzt werden. Vakuumverpackung und Lichtschutz helfen, die Farbe länger zu erhalten und die benötigte Nitritmenge zu reduzieren [11].
Gesundheitliche Auswirkungen
Die gesundheitlichen Wirkungen von Natriumnitrit sind seit Jahrzehnten Gegenstand intensiver Forschung und kontroverser Diskussionen. Während die akute Toxizität gut verstanden ist, gibt es bei den Langzeitwirkungen noch offene Fragen. Die Bewertung wird dadurch erschwert, dass Nitrit im Körper vielfältige Reaktionen eingehen kann - manche davon sind nützlich, andere potenziell schädlich. Die Dosis, die Art der Aufnahme und individuelle Faktoren bestimmen, welche Effekte überwiegen.
Ein zentrales Problem bei der Risikobewertung ist die Unterscheidung zwischen Nitrit aus verschiedenen Quellen. Nitrit aus Gemüse, das reich an Vitamin C und anderen Antioxidantien ist, wirkt anders als Nitrit aus verarbeitetem Fleisch. Epidemiologische Studien zeigen, dass der Verzehr von nitratreichem Gemüse mit gesundheitlichen Vorteilen verbunden ist, während verarbeitetes Fleisch das Risiko für bestimmte Krankheiten erhöht. Diese scheinbar widersprüchlichen Befunde lassen sich durch die unterschiedliche Matrix und die Begleitstoffe erklären [12].
Akute Toxizität und Methämoglobinbildung
Bei einer akuten Überdosierung kann Nitrit zu einer lebensbedrohlichen Methämoglobinämie führen. Dabei oxidiert Nitrit das zweiwertige Eisen im Hämoglobin zu dreiwertigem Eisen. Das entstehende Methämoglobin kann keinen Sauerstoff mehr transportieren. Schon bei einem Methämoglobin-Anteil von 10 Prozent treten erste Symptome wie Müdigkeit und Kopfschmerzen auf. Bei 20 bis 30 Prozent kommt es zu Atemnot und Blaufärbung der Haut. Werte über 50 Prozent können tödlich sein [13].
Säuglinge unter sechs Monaten sind besonders gefährdet. Ihr Hämoglobin (fetales Hämoglobin) wird leichter oxidiert, und das Enzym, das Methämoglobin wieder reduziert (Methämoglobin-Reduktase), ist noch nicht voll aktiv. Zudem haben Säuglinge einen höheren Magen-pH, wodurch mehr Nitrat zu Nitrit umgewandelt wird. Aus diesem Grund dürfen Babynahrung und Getränke für Säuglinge kein zugesetztes Nitrit enthalten. Die früher häufigen Vergiftungen durch nitratreiches Brunnenwasser („Blue-Baby-Syndrom“) sind heute in Deutschland durch strenge Grenzwerte für Trinkwasser selten geworden [14].
Die tödliche Dosis für Erwachsene liegt bei etwa 2 bis 6 Gramm Natriumnitrit, entsprechend 30 bis 90 mg pro Kilogramm Körpergewicht. Vergiftungen treten meist durch Verwechslungen auf, wenn Nitritpökelsalz statt normalem Salz verwendet wird. Die Symptome entwickeln sich innerhalb von 30 bis 60 Minuten nach der Aufnahme. Die Behandlung erfolgt durch Gabe von Methylenblau, das die Reduktion von Methämoglobin beschleunigt, sowie durch Sauerstoffgabe und unterstützende Maßnahmen [15].
Nitrosaminbildung und Krebsrisiko
Die größte Sorge gilt der Bildung von N-Nitrosoverbindungen, kurz Nitrosamine genannt. Diese entstehen, wenn Nitrit mit sekundären Aminen reagiert - Verbindungen, die in vielen Lebensmitteln vorkommen. Die Reaktion wird durch Säure begünstigt und läuft besonders gut bei pH-Werten zwischen 2 und 4 ab, wie sie im Magen herrschen. Von den etwa 300 bekannten Nitrosaminen haben sich 90 Prozent im Tierversuch als krebserregend erwiesen. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stuft mehrere Nitrosamine als „wahrscheinlich krebserregend für Menschen“ ein [16].
Die Nitrosaminbildung kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Vitamin C (Ascorbinsäure) und Vitamin E (Tocopherole) wirken als Inhibitoren, indem sie Nitrit abfangen, bevor es mit Aminen reagieren kann. Deshalb wird Pökelprodukten oft Ascorbat zugesetzt - in der EU sind bis zu 500 mg pro Kilogramm erlaubt. Polyphenole aus Gewürzen und Kräutern haben eine ähnliche Schutzwirkung. Andererseits fördern bestimmte Bedingungen die Nitrosaminbildung: hohe Temperaturen beim Braten oder Grillen, lange Lagerzeiten und die Anwesenheit von Häm-Eisen aus dem Fleisch [17].
| Lebensmittel | Nitrosamingehalt (μg/kg) | Hauptnitrosamine | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Rohschinken | 1-5 | NDMA, NPYR | Niedrige Werte durch lange Reifung |
| Salami | 2-10 | NDMA, NDEA | Abhängig von Reifedauer |
| Gebratener Speck | 10-40 | NDMA, NPYR | Hohe Werte durch Erhitzung |
| Leberwurst | 1-3 | NDMA | Geringe Bildung bei niedrigen Temperaturen |
| Grillwurst | 5-20 | NDMA, NPYR | Starke Zunahme beim Grillen |
| Fisch, geräuchert | 1-10 | NDMA | Bildung beim Räucherprozess |
| Bier | 0,1-0,5 | NDMA | Aus gemälzter Gerste |
| Käse | 1-5 | NDMA, NDEA | Nur in gereiften Sorten |
Epidemiologische Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von verarbeitetem Fleisch und verschiedenen Krebsarten, besonders Darmkrebs. Die IARC hat 2015 verarbeitetes Fleisch als „krebserregend für Menschen“ (Gruppe 1) eingestuft. Pro 50 Gramm verarbeitetes Fleisch täglich steigt das Darmkrebsrisiko um etwa 18 Prozent. Allerdings ist unklar, welchen Anteil Nitrit und Nitrosamine an diesem Risiko haben. Andere Faktoren wie der hohe Fett- und Salzgehalt, Häm-Eisen und beim Erhitzen entstehende Substanzen tragen vermutlich ebenfalls bei [18].
Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System
Überraschenderweise hat Nitrit auch positive Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Im Körper wird Nitrit zu Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt, einem wichtigen Signalmolekül. NO erweitert die Blutgefäße, senkt den Blutdruck und verbessert die Durchblutung. Diese Wirkung nutzt man medizinisch: Nitroglycerin, ein Medikament gegen Angina pectoris, wirkt über die Freisetzung von NO. Studien zeigen, dass nitratreiches Gemüse den Blutdruck senken und die Gefäßfunktion verbessern kann [19].
Die gefäßerweiternde Wirkung von Nitrit tritt bereits bei Konzentrationen auf, die durch normale Ernährung erreicht werden. Nach dem Verzehr von nitratreichem Gemüsesaft steigt die Nitritkonzentration im Blut auf 0,5 bis 2 μM an. Diese Menge reicht aus, um messbare Effekte auf den Blutdruck zu haben. Bei gesunden Menschen sinkt der systolische Blutdruck um 4 bis 5 mmHg. Bei Patienten mit Bluthochdruck kann die Senkung noch stärker ausfallen. Die Wirkung hält mehrere Stunden an und wird durch regelmäßigen Verzehr verstärkt [20].
Allerdings gibt es wichtige Unterschiede zwischen Nitrit aus Gemüse und aus Fleischprodukten. Gemüse enthält Antioxidantien, die die NO-Bildung fördern und gleichzeitig die Nitrosaminbildung hemmen. Fleischprodukte enthalten dagegen Häm-Eisen und gesättigte Fette, die die positiven Effekte abschwächen oder aufheben können. Tatsächlich zeigen Studien, dass der Verzehr von verarbeitetem Fleisch trotz des Nitritgehalts mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden ist [21].
Natürliche Quellen und Aufnahmemengen
Die Vorstellung, dass Nitrit nur ein künstlicher Zusatzstoff ist, entspricht nicht der Realität. Der menschliche Körper produziert selbst Nitrit aus Nitrat, und viele Lebensmittel enthalten von Natur aus diese Verbindungen. Tatsächlich stammt der größte Teil des Nitrits im Körper nicht aus gepökelten Fleischprodukten, sondern aus der körpereigenen Umwandlung von Nitrat aus Gemüse. Diese Erkenntnis hat in den letzten Jahren zu einer differenzierteren Betrachtung der Nitritproblematik geführt.
Die durchschnittliche tägliche Nitrataufnahme in Deutschland liegt bei 50 bis 150 mg, wobei 80 bis 85 Prozent aus Gemüse stammen. Im Speichel wird etwa 5 bis 7 Prozent dieses Nitrats durch Bakterien zu Nitrit reduziert. Das bedeutet, dass allein durch diese Umwandlung täglich 2,5 bis 10 mg Nitrit entstehen - mehr als die 1 bis 3 mg, die durchschnittlich über gepökelte Produkte aufgenommen werden. Vegetarier haben durch ihren höheren Gemüsekonsum sogar eine noch höhere endogene Nitritbildung [22].
Nitrit in verschiedenen Lebensmitteln
Gemüse ist die Hauptquelle für Nitrat in der Ernährung, enthält aber nur wenig Nitrit. Blattgemüse wie Spinat, Rucola und Feldsalat können über 2000 mg Nitrat pro Kilogramm enthalten. Wurzelgemüse wie Rote Bete, Radieschen und Rettich liegen bei 1000 bis 1500 mg pro Kilogramm. Der Nitritgehalt in frischem Gemüse liegt dagegen meist unter 2 mg pro Kilogramm. Erst bei unsachgemäßer Lagerung oder Zubereitung kann durch bakterielle Aktivität mehr Nitrit entstehen [23].
| Lebensmittel | Nitratgehalt (mg/kg) | Nitritgehalt (mg/kg) | Typische Verzehrmenge (g) |
|---|---|---|---|
| Rucola | 2000-4000 | <2 | 30-50 |
| Spinat | 1000-3000 | <2 | 150-200 |
| Rote Bete | 1000-2500 | <2 | 100-150 |
| Kopfsalat | 500-2000 | <1 | 50-100 |
| Radieschen | 1000-1800 | <1 | 50-100 |
| Kartoffeln | 50-200 | <1 | 200-300 |
| Tomaten | 10-50 | <1 | 100-150 |
| Schinken, gekocht | 10-50 | 20-60 | 30-50 |
| Salami | 10-40 | 30-80 | 30-50 |
| Leberwurst | 5-20 | 10-40 | 30-50 |
Fleischprodukte enthalten durch die Pökelung direkt Nitrit. Die tatsächlichen Gehalte liegen meist bei 20 bis 60 mg pro Kilogramm, deutlich unter den erlaubten Höchstwerten. Während der Lagerung nimmt der Nitritgehalt ab, da es mit Fleischbestandteilen reagiert. Nach vier Wochen ist oft nur noch die Hälfte des ursprünglichen Nitrits nachweisbar. Bio-Produkte dürfen maximal 80 mg Nitrit pro Kilogramm enthalten, konventionelle Produkte bis zu 150 mg [24].
Trinkwasser darf in der EU maximal 50 mg Nitrat und 0,5 mg Nitrit pro Liter enthalten. Die tatsächlichen Werte liegen meist deutlich darunter. In Deutschland enthält Leitungswasser durchschnittlich 10 bis 25 mg Nitrat pro Liter. Probleme gibt es hauptsächlich in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten, wo durch Überdüngung Nitrat ins Grundwasser gelangt. Mineralwässer müssen strengere Grenzwerte einhalten: maximal 10 mg Nitrat pro Liter für Säuglingsnahrung [25].
Körpereigene Nitritproduktion
Der menschliche Körper produziert täglich etwa 1 mg Nitrit pro Kilogramm Körpergewicht - bei einem 70 kg schweren Menschen also etwa 70 mg. Diese endogene Produktion übersteigt die Aufnahme über die Nahrung deutlich. Das Nitrit entsteht hauptsächlich aus zwei Quellen: der bakteriellen Reduktion von Nitrat im Mund und der enzymatischen Oxidation von L-Arginin durch NO-Synthasen. Beide Wege haben wichtige physiologische Funktionen [26].
Im Mund leben Bakterien, die das Enzym Nitratreduktase besitzen. Sie wandeln etwa 5 bis 7 Prozent des mit dem Speichel ausgeschiedenen Nitrats zu Nitrit um. Pro Tag werden 500 bis 1500 mg Nitrat über die Speicheldrüsen sezerniert - das Zehnfache der Nahrungsaufnahme. Diese scheinbare Verschwendung hat einen Sinn: Das entstehende Nitrit wirkt antibakteriell und schützt vor Karies und Zahnfleischentzündungen. Mundspülungen mit antibakteriellen Wirkstoffen können diese nützliche Nitritbildung stören [27].
Die NO-Synthasen produzieren Stickstoffmonoxid aus der Aminosäure L-Arginin. Dieses NO wird schnell zu Nitrit und dann zu Nitrat oxidiert. Die tägliche Produktion liegt bei 0,5 bis 1 mmol, entsprechend 25 bis 50 mg Nitrit. Diese endogene Produktion steigt bei Infektionen und Entzündungen stark an, da NO Teil der Immunabwehr ist. Makrophagen können große Mengen NO produzieren, um Bakterien und andere Erreger abzutöten [28].
Regulierung und Grenzwerte
Die Verwendung von Natriumnitrit in Lebensmitteln wird weltweit streng kontrolliert. Die Regulierungen basieren auf jahrzehntelanger Forschung und berücksichtigen sowohl die notwendige Schutzwirkung gegen gefährliche Bakterien als auch die potenziellen Gesundheitsrisiken. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern und Regionen, die kulturelle Traditionen, Verzehrgewohnheiten und unterschiedliche Risikobewertungen widerspiegeln.
In der Europäischen Union regelt die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 über Lebensmittelzusatzstoffe die Verwendung von Nitrit. Die Grenzwerte wurden mehrfach angepasst, zuletzt 2023. Dabei wurde berücksichtigt, dass moderne Produktions- und Lagerverfahren geringere Nitritmengen erfordern. Gleichzeitig wurden für traditionell hergestellte Produkte Ausnahmen geschaffen, um regionale Spezialitäten zu erhalten. Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Kontrollen der Lebensmittelüberwachung [29].
- Gepökelte Fleischerzeugnisse allgemein: maximal 150 mg/kg Restnitrit im Endprodukt, berechnet als Natriumnitrit
- Traditionell gepökelte Produkte (z.B. Wiltshire-Speck, bestimmte Schinkenarten): bis zu 175 mg/kg unter speziellen Bedingungen
- Bio-Produkte nach EU-Öko-Verordnung: maximal 80 mg/kg Natriumnitrit
- Babynahrung und Lebensmittel für Kleinkinder: Verwendung von Nitrit komplett verboten
- Fischerzeugnisse: in bestimmten Ländern für traditionelle Produkte erlaubt, sonst verboten
Die USA haben andere Regelungen. Die Food and Drug Administration (FDA) erlaubt 200 mg Natriumnitrit pro Kilogramm in gepökeltem Fleisch und Geflügel. Zusätzlich müssen mindestens 550 mg Ascorbat oder Erythorbat pro Kilogramm zugesetzt werden, um die Nitrosaminbildung zu hemmen. Für Bacon gelten seit 1978 spezielle Regeln: maximal 120 mg Nitrit pro Kilogramm bei gleichzeitiger Zugabe von 550 mg Ascorbat. Diese Maßnahme hat den Nitrosamingehalt in Bacon um 80 Prozent reduziert [30].
ADI-Werte und Sicherheitsbewertung
Der ADI-Wert (Acceptable Daily Intake) gibt an, welche Menge einer Substanz ein Mensch lebenslang täglich aufnehmen kann, ohne dass gesundheitliche Schäden zu erwarten sind. Für Nitrit hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 2017 einen ADI von 0,07 mg pro Kilogramm Körpergewicht festgelegt. Für einen 70 kg schweren Erwachsenen entspricht das 4,9 mg Nitrit-Ion täglich. Dieser Wert enthält einen Sicherheitsfaktor von 100 - die tatsächlich schädliche Dosis liegt also hundertmal höher [31].
Für Nitrat gilt ein ADI von 3,7 mg pro Kilogramm Körpergewicht, also 259 mg für einen 70 kg schweren Menschen. Diese Menge wird bei normaler Ernährung selten überschritten. Problematisch kann es bei einseitiger Ernährung mit sehr viel nitratreichem Gemüse werden. Ein Kilogramm Spinat kann bereits die ADI-Menge enthalten. Allerdings zeigen Studien, dass die gesundheitlichen Vorteile von Gemüse die theoretischen Risiken durch Nitrat überwiegen [32].
Die Sicherheitsbewertung wird regelmäßig überprüft und an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst. 2023 hat die EFSA eine erneute Bewertung durchgeführt und dabei besonders die Nitrosaminbildung berücksichtigt. Die Behörde kam zu dem Schluss, dass die derzeitigen Grenzwerte ausreichend Schutz bieten, wenn gleichzeitig Maßnahmen zur Minimierung der Nitrosaminbildung getroffen werden. Dazu gehören der Zusatz von Ascorbat, niedrige Lagertemperaturen und kurze Lagerzeiten [33].
Monitoring und Kontrollen
Die Einhaltung der Grenzwerte wird in Deutschland durch die amtliche Lebensmittelüberwachung kontrolliert. Jährlich werden tausende Proben von Fleischprodukten auf ihren Nitrit- und Nitratgehalt untersucht. Die Beanstandungsquote liegt bei etwa 2 bis 3 Prozent, meist wegen Überschreitung der Höchstwerte oder fehlender Kennzeichnung. Bei Verstößen drohen Bußgelder und im Wiederholungsfall der Entzug der Betriebserlaubnis [34].
Neben der amtlichen Überwachung führen viele Hersteller eigene Kontrollen durch. Große Fleischverarbeiter analysieren jede Charge auf Nitrit und dokumentieren die Werte. Moderne Schnelltests ermöglichen eine Kontrolle direkt in der Produktion. Die Messung erfolgt meist photometrisch nach der Griess-Reaktion, bei der Nitrit einen roten Farbstoff bildet. Die Nachweisgrenze liegt bei etwa 0,5 mg pro Kilogramm [35].
Alternativen und Reduktionsstrategien
Der Druck auf die Lebensmittelindustrie, den Einsatz von Natriumnitrit zu reduzieren oder Alternativen zu finden, wächst stetig. Verbraucher fordern „saubere“ Zutatenlisten, Gesundheitsbehörden mahnen zur Vorsicht, und neue Studien nähren die Bedenken. Die Industrie reagiert mit verschiedenen Strategien: Reduktion der Nitritmenge, Einsatz natürlicher Nitritquellen und Entwicklung nitritfreier Alternativen. Jeder Ansatz hat Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
Die einfachste Strategie ist die Reduktion der eingesetzten Nitritmenge auf das technologisch notwendige Minimum. Moderne Herstellungsverfahren mit optimierter Hygiene, Kühlung und Verpackung ermöglichen geringere Nitritmengen. Viele Hersteller arbeiten heute mit 40 bis 60 mg pro Kilogramm statt der erlaubten 150 mg. Allerdings stößt diese Reduktion an Grenzen: Unter 40 mg pro Kilogramm wird der Schutz vor Clostridium botulinum unsicher, besonders bei längerer Lagerung oder Temperaturmissbrauch [36].
Natürliche Nitritquellen
Ein beliebter Ansatz ist die Verwendung „natürlicher“ Nitritquellen wie Gemüsepulver aus Sellerie, Spinat oder Roter Bete. Diese enthalten hohe Mengen Nitrat, das durch zugesetzte Starterkulturen zu Nitrit umgewandelt wird. Produkte mit solchen Zutaten werden oft als „ohne zugesetztes Nitrit“ beworben. Chemisch macht es jedoch keinen Unterschied, ob das Nitrit direkt zugesetzt oder aus Gemüse gebildet wird - die Wirkungen und Risiken sind identisch [37].
Die Verwendung von Gemüsepulvern hat sogar Nachteile: Die Nitritmenge ist schwerer zu kontrollieren, da die Umwandlung von Nitrat zu Nitrit von vielen Faktoren abhängt. Die Endkonzentration kann stark schwanken, was sowohl die Sicherheit als auch die Qualität beeinträchtigt. Zudem sind diese Produkte teurer und können einen unerwünschten Gemüsegeschmack mitbringen. Studien zeigen, dass „natürlich“ gepökelte Produkte oft höhere und variablere Nitritgehalte aufweisen als konventionell gepökelte [38].
Manche Hersteller experimentieren mit pflanzlichen Extrakten, die sowohl antimikrobielle als auch antioxidative Eigenschaften haben. Rosmarin-, Oregano- und Grüntee-Extrakte zeigen in Laborversuchen vielversprechende Ergebnisse. Sie können das Wachstum unerwünschter Bakterien hemmen und gleichzeitig die Oxidation von Fetten verhindern. Allerdings erreichen sie nicht die Wirksamkeit von Nitrit gegen Clostridien und können den Geschmack stark beeinflussen [39].
Technologische Alternativen
Die Hochdruckbehandlung (HPP - High Pressure Processing) kann Bakterien abtöten, ohne das Produkt zu erhitzen. Bei Drücken von 400 bis 600 MPa werden vegetative Bakterienzellen zerstört, während Geschmack und Nährwert erhalten bleiben. Allerdings sind Sporen von Clostridien druckresistent, weshalb HPP allein Nitrit nicht ersetzen kann. In Kombination mit anderen Hürden wie niedrigem pH-Wert oder natürlichen Konservierungsstoffen kann aber die Nitritmenge reduziert werden [40].
Neue Verpackungstechnologien tragen ebenfalls zur Nitritreduktion bei. Aktive Verpackungen können Sauerstoff absorbieren oder antimikrobielle Substanzen freisetzen. Intelligente Verpackungen zeigen durch Farbumschlag an, ob das Produkt noch sicher ist. Modifizierte Atmosphären mit erhöhtem CO₂-Gehalt hemmen das Bakterienwachstum. Diese Technologien sind jedoch teuer und erfordern Investitionen in neue Anlagen [41].
Die Fermentation mit ausgewählten Starterkulturen bietet weitere Möglichkeiten. Milchsäurebakterien senken den pH-Wert und produzieren antimikrobielle Substanzen wie Bakteriozine. Einige Stämme bilden sogar Stickstoffmonoxid und können so zur Umrötung beitragen. Fermentierte Würste wie Salami kommen teilweise mit sehr wenig oder ohne Nitrit aus. Für Kochpökelwaren ist dieser Ansatz jedoch nur begrenzt geeignet [42].
Empfehlungen für Verbraucher
Angesichts der komplexen Datenlage stellen sich Verbraucher die Frage: Wie gefährlich ist Natriumnitrit wirklich, und wie kann ich meine Aufnahme sinnvoll reduzieren? Die Antwort ist differenziert. Während die akuten Risiken bei normalen Verzehrmengen vernachlässigbar sind, deuten Langzeitstudien auf mögliche Gesundheitsrisiken hin. Gleichzeitig schützt Nitrit vor gefährlichen Lebensmittelinfektionen. Ein vollständiger Verzicht auf alle nitrithaltigen Produkte ist weder notwendig noch sinnvoll, aber eine bewusste Reduktion kann das persönliche Risiko senken.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurstwaren pro Woche zu verzehren, wobei der Anteil verarbeiteter Produkte möglichst gering sein sollte. Diese Empfehlung basiert nicht nur auf dem Nitritgehalt, sondern berücksichtigt auch andere Faktoren wie den hohen Salz- und Fettgehalt. Wer diese Empfehlung befolgt, nimmt automatisch weniger Nitrit auf. Die durchschnittliche Aufnahme würde dann bei etwa 0,5 bis 1 mg täglich liegen - weit unter dem ADI-Wert [43].
Tipps zur Reduktion der Nitritaufnahme
Beim Einkauf lohnt ein Blick auf die Zutatenliste. Nitrit wird als „Natriumnitrit“, „E 250“ oder als Bestandteil von „Nitritpökelsalz“ deklariert. Bio-Produkte enthalten maximal 80 mg pro Kilogramm statt der konventionellen 150 mg. Frisches, unverarbeitetes Fleisch enthält kein zugesetztes Nitrit und ist daher die bessere Wahl für den regelmäßigen Verzehr. Traditionell hergestellte Produkte mit langer Reifezeit enthalten oft weniger Restnitrit als schnell produzierte Massenware.
Die Zubereitung beeinflusst die Nitrosaminbildung erheblich. Gepökelte Produkte sollten nicht stark erhitzt werden - also besser kochen oder dünsten statt braten oder grillen. Speck sollte bei niedrigen Temperaturen langsam ausgebraten werden. Das gleichzeitige Verzehren von Vitamin-C-reichem Obst oder Gemüse hemmt die Nitrosaminbildung im Magen. Ein Glas Orangensaft zum Frühstück mit Schinken ist also durchaus sinnvoll [44].
Bei der Lagerung gilt: Je frischer, desto besser. Während der Lagerung können sich Nitrosamine bilden, besonders bei unsachgemäßer Aufbewahrung. Angebrochene Packungen sollten schnell verbraucht werden. Einfrieren stoppt die Nitrosaminbildung, kann aber die Qualität beeinträchtigen. Gepökelte Produkte sollten nicht zusammen mit nitratreichem Gemüse gelagert werden, da Kreuzkontaminationen möglich sind [45].
Risikogruppen und besondere Vorsicht
Bestimmte Personengruppen sollten besonders auf ihre Nitritaufnahme achten. Schwangere und Stillende sollten den Verzehr gepökelter Produkte minimieren, da Nitrit und Nitrosamine die Plazenta passieren und in die Muttermilch übergehen können. Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen hoher mütterlicher Nitritaufnahme und bestimmten Geburtsfehlern, wobei die Kausalität nicht eindeutig geklärt ist [46].
Kleinkinder unter drei Jahren reagieren empfindlicher auf Nitrit als Erwachsene. Ihr Enzymsystem ist noch nicht voll entwickelt, und sie haben ein höheres Risiko für Methämoglobinämie. Gepökelte Produkte sollten daher nur gelegentlich und in kleinen Mengen gegeben werden. Selbst zubereiteter Spinat- oder Rote-Bete-Brei sollte nicht aufgewärmt werden, da sich dabei Nitrit bilden kann [47].
Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen oder familiärer Vorbelastung für Darmkrebs wird oft geraten, ihren Verzehr von verarbeitetem Fleisch stark einzuschränken. Studien zeigen, dass diese Gruppen ein erhöhtes Risiko für nitrosamin-bedingte DNA-Schäden haben. Eine Ernährung reich an Ballaststoffen, Obst und Gemüse kann das Risiko teilweise kompensieren [48].
Aktuelle Forschung und Zukunftsperspektiven
Die Forschung zu Natriumnitrit ist längst nicht abgeschlossen. Neue analytische Methoden ermöglichen genauere Messungen von Nitrosaminen und deren Vorstufen. Molekularbiologische Techniken helfen, die Mechanismen der Krebsentstehung besser zu verstehen. Gleichzeitig werden die positiven Effekte von Nitrit auf das Herz-Kreislauf-System intensiv erforscht. Diese scheinbar widersprüchlichen Erkenntnisse fordern eine Neubewertung der Nutzen-Risiko-Bilanz.
Ein vielversprechender Forschungsansatz ist die Entwicklung von „Designer-Nitrit“ - modifizierten Verbindungen, die die antimikrobielle Wirkung behalten, aber keine Nitrosamine bilden. Wissenschaftler arbeiten an Nitrit-Derivaten, die selektiv mit Bakterien reagieren, aber nicht mit Aminen. Erste Laborversuche zeigen interessante Ergebnisse, aber bis zur Marktreife ist es noch ein weiter Weg. Die Zulassung neuer Lebensmittelzusatzstoffe dauert Jahre und erfordert umfangreiche Sicherheitsstudien [49].
Die Mikrobiomforschung liefert neue Erkenntnisse zur Rolle der Darmbakterien bei der Nitritverarbeitung. Bestimmte Bakterienstämme können Nitrit zu harmlosen Verbindungen abbauen, während andere die Nitrosaminbildung fördern. Möglicherweise lässt sich durch Probiotika oder präbiotische Substanzen das Risiko reduzieren. Studien zeigen, dass Menschen mit einem diversen Mikrobiom weniger anfällig für nitrit-bedingte Schäden sind [50].
Die personalisierte Ernährung könnte in Zukunft individuelle Empfehlungen ermöglichen. Genetische Varianten beeinflussen, wie effizient der Körper Nitrit und Nitrosamine entgiftet. Menschen mit bestimmten Enzymvarianten haben ein höheres Krebsrisiko durch verarbeitetes Fleisch. Gentests könnten helfen, Risikogruppen zu identifizieren und gezielte Präventionsstrategien zu entwickeln. Allerdings sind die Zusammenhänge komplex, und einzelne Genmarker haben nur begrenzte Aussagekraft [51].
Fazit
Die Bewertung von Natriumnitrit in der Ernährung bleibt eine Herausforderung. Einerseits ist die Substanz ein effektiver Schutz vor lebensbedrohlichen Lebensmittelinfektionen und hat überraschende positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System. Andererseits bestehen berechtigte Sorgen über die Bildung krebserregender Nitrosamine und die Assoziation mit verschiedenen Krankheiten. Die Wissenschaft kann keine einfache Antwort auf die Frage geben, ob Nitrit gut oder schlecht ist - die Wahrheit liegt in der Mitte.
Für Verbraucher bedeutet das: Ein bewusster, aber nicht ängstlicher Umgang mit nitrithaltigen Produkten ist angebracht. Der gelegentliche Verzehr von hochwertigem Schinken oder Salami ist unbedenklich, der tägliche Konsum großer Mengen verarbeiteten Fleisches sollte vermieden werden. Die größten Gesundheitsrisiken gehen nicht vom Nitrit selbst aus, sondern vom übermäßigen Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch insgesamt. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse bietet den besten Schutz.
Die Lebensmittelindustrie steht vor der Aufgabe, sichere und gleichzeitig gesündere Produkte zu entwickeln. Die vollständige Eliminierung von Nitrit ist derzeit nicht möglich, ohne die mikrobiologische Sicherheit zu gefährden. Aber durch optimierte Rezepturen, moderne Technologien und sorgfältige Prozesskontrolle lassen sich die Risiken minimieren. Transparente Kommunikation über Inhaltsstoffe und Herstellungsverfahren hilft Verbrauchern, informierte Entscheidungen zu treffen.
Die Forschung wird in den kommenden Jahren weitere Erkenntnisse liefern. Neue analytische Methoden, epidemiologische Studien und molekularbiologische Untersuchungen werden unser Verständnis vertiefen. Möglicherweise werden innovative Alternativen entwickelt, die Nitrit überflüssig machen. Bis dahin bleibt Natriumnitrit ein notwendiger Kompromiss zwischen Lebensmittelsicherheit und potenziellen Gesundheitsrisiken - ein Balanceakt, der sorgfältige Abwägung erfordert.
📚 Quellenverzeichnis (51 Quellen)
Quellenverzeichnis
- Lundberg JO, Weitzberg E, Gladwin MT. The nitrate-nitrite-nitric oxide pathway in physiology and therapeutics. Nature Reviews Drug Discovery. 2008;7(2):156-167.
- Honikel KO. The use and control of nitrate and nitrite for the processing of meat products. Meat Science. 2008;78(1-2):68-76.
- Bedale W, Sindelar JJ, Milkowski AL. Dietary nitrate and nitrite: Benefits, risks, and evolving perceptions. Meat Science. 2016;120:85-92.
- European Food Safety Authority. Re-evaluation of sodium nitrite (E 250) as a food additive. EFSA Journal. 2017;15(6):4786.
- Sebranek JG, Bacus JN. Cured meat products without direct addition of nitrate or nitrite: what are the issues? Meat Science. 2007;77(1):136-147.
- Sindelar JJ, Milkowski AL. Human safety controversies surrounding nitrate and nitrite in the diet. Nitric Oxide. 2012;26(4):259-266.
- Hospital XF, Hierro E, Fernández M. Effect of reducing nitrate and nitrite added to dry fermented sausages on the survival of Clostridium sporogenes. Food Research International. 2014;62:410-415.
- Majou D, Christieans S. Mechanisms of the bactericidal effects of nitrate and nitrite in cured meats. Meat Science. 2018;145:273-284.
- Alahakoon AU, Jayasena DD, Ramachandra S, Jo C. Alternatives to nitrite in processed meat: Up to date. Trends in Food Science & Technology. 2015;45(1):37-49.
- Pegg RB, Shahidi F. Nitrite curing of meat: The N-nitrosamine problem and nitrite alternatives. Food & Nutrition Press. 2000.
- Parthasarathy DK, Bryan NS. Sodium nitrite: The „cure“ for nitric oxide insufficiency. Meat Science. 2012;92(3):274-279.
- Song P, Wu L, Guan W. Dietary nitrates, nitrites, and nitrosamines intake and the risk of gastric cancer: A meta-analysis. Nutrients. 2015;7(12):9872-9895.
- Greer FR, Shannon M. Infant methemoglobinemia: the role of dietary nitrate in food and water. Pediatrics. 2005;116(3):784-786.
- Katan MB. Nitrate in foods: harmful or healthy? American Journal of Clinical Nutrition. 2009;90(1):11-12.
- Wright RO, Lewander WJ, Woolf AD. Methemoglobinemia: etiology, pharmacology, and clinical management. Annals of Emergency Medicine. 1999;34(5):646-656.
- International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 114: Red Meat and Processed Meat. Lyon: IARC; 2018.
- Herrmann SS, Duedahl-Olesen L, Granby K. Occurrence of volatile and non-volatile N-nitrosamines in processed meat products and the role of heat treatment. Food Control. 2015;48:163-169.
- Bouvard V, Loomis D, Guyton KZ, et al. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncology. 2015;16(16):1599-1600.
- Bryan NS, Alexander DD, Coughlin JR, Milkowski AL, Boffetta P. Ingested nitrate and nitrite and stomach cancer risk: an updated review. Food and Chemical Toxicology. 2012;50(10):3646-3665.
- Webb AJ, Patel N, Loukogeorgakis S, et al. Acute blood pressure lowering, vasoprotective, and antiplatelet properties of dietary nitrate via bioconversion to nitrite. Hypertension. 2008;51(3):784-790.
- Micha R, Wallace SK, Mozaffarian D. Red and processed meat consumption and risk of incident coronary heart disease, stroke, and diabetes mellitus. Circulation. 2010;121(21):2271-2283.
- Hord NG, Tang Y, Bryan NS. Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for potential health benefits. American Journal of Clinical Nutrition. 2009;90(1):1-10.
- Santamaria P. Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2006;86(1):10-17.
- Bundesinstitut für Risikobewertung. Nitrat und Nitrit in Lebensmitteln. Stellungnahme Nr. 034/2013. Berlin: BfR; 2013.
- World Health Organization. Nitrate and nitrite in drinking-water: Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. Geneva: WHO; 2016.
- Weitzberg E, Lundberg JO. Novel aspects of dietary nitrate and human health. Annual Review of Nutrition. 2013;33:129-159.
- Hyde ER, Luk B, Cron S, et al. Characterization of the rat oral microbiome and the effects of dietary nitrate. Free Radical Biology and Medicine. 2014;77:249-257.
- Kelm M. Nitric oxide metabolism and breakdown. Biochimica et Biophysica Acta. 1999;1411(2-3):273-289.
- European Commission. Commission Regulation (EU) 2023/2108 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008. Official Journal of the European Union. 2023.
- United States Department of Agriculture. Processing Inspectors‘ Calculations Handbook. FSIS Directive 7620.3. Washington: USDA; 2022.
- European Food Safety Authority. Statement on the update of the list of QPS-recommended biological agents. EFSA Journal. 2023;21(1):7746.
- Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Evaluation of certain food additives and contaminants. WHO Technical Report Series 1040. Geneva: WHO; 2023.
- Mortensen A, Aguilar F, Crebelli R, et al. Re-evaluation of sodium nitrate (E 251) and potassium nitrate (E 252) as food additives. EFSA Journal. 2017;15(6):4787.
- Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Jahresbericht 2023 zur Lebensmittelüberwachung. Berlin: BVL; 2024.
- International Organization for Standardization. ISO 2918:1975 Meat and meat products - Determination of nitrite content. Geneva: ISO; 2018.
- Riel G, Boulaaba A, Popp J, Klein G. Effects of parsley extract powder as an alternative for the direct addition of sodium nitrite in the production of mortadella-type sausages. Meat Science. 2017;131:166-175.
- Sebranek JG, Jackson-Davis AL, Myers KL, Lavieri NA. Beyond celery and starter culture: advances in natural/organic curing processes in the United States. Meat Science. 2012;92(3):267-273.
- Sindelar JJ, Cordray JC, Sebranek JG, Love JA, Ahn DU. Effects of varying levels of vegetable juice powder and incubation time on color, residual nitrate and nitrite, pigment, pH, and trained sensory attributes of ready-to-eat uncured ham. Journal of Food Science. 2007;72(6):388-395.
- Viuda-Martos M, Ruiz-Navajas Y, Fernández-López J, Pérez-Álvarez JA. Spices as functional foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2011;51(1):13-28.
- Simonin H, Duranton F, de Lamballerie M. New insights into the high-pressure processing of meat and meat products. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2012;11(3):285-306.
- Amit SK, Uddin MM, Rahman R, Islam SMR, Khan MS. A review on mechanisms and commercial aspects of food preservation and processing. Agriculture & Food Security. 2017;6(1):51.
- Lorenzo JM, Munekata PES, Dominguez R, Pateiro M, Saraiva JA, Franco D. Main groups of microorganisms of relevance for food safety and stability. Innovative Technologies for Food Preservation. 2018:53-107.
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE. Bonn: DGE; 2023.
- Crowe W, Elliott CT, Green BD. A review of the in vivo evidence investigating the role of nitrite exposure from processed meat consumption in the development of colorectal cancer. Nutrients. 2019;11(11):2673.
- De Mey E, De Maere H, Paelinck H, Fraeye I. Volatile N-nitrosamines in meat products: Potential precursors, influence of processing, and mitigation strategies. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2017;57(13):2909-2923.
- Andersson R, Östman E, Björck I. Nitrite tolerance in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2023;46(2):289-295.
- Inoue-Choi M, Jones RR, Anderson KE, et al. Nitrate and nitrite ingestion and risk of ovarian cancer among postmenopausal women in Iowa. International Journal of Cancer. 2015;137(1):173-182.
- Cross AJ, Freedman ND, Ren J, et al. Meat consumption and risk of esophageal and gastric cancer in a large prospective study. American Journal of Gastroenterology. 2011;106(3):432-442.
- Flores M, Toldrá F. Chemistry, safety, and regulatory considerations in the use of nitrite and nitrate from natural origin in meat products. Meat Science. 2021;171:108272.
- Dellavalle CT, Xiao Q, Yang G, et al. Dietary nitrate and nitrite intake and risk of colorectal cancer in the Shanghai Women’s Health Study. International Journal of Cancer. 2014;134(12):2917-2926.
- Van den Brand AD, Beukers M, Niekerk M, et al. Assessment of the combined nitrate and nitrite exposure from food and drinking water. RIVM Report. 2020.