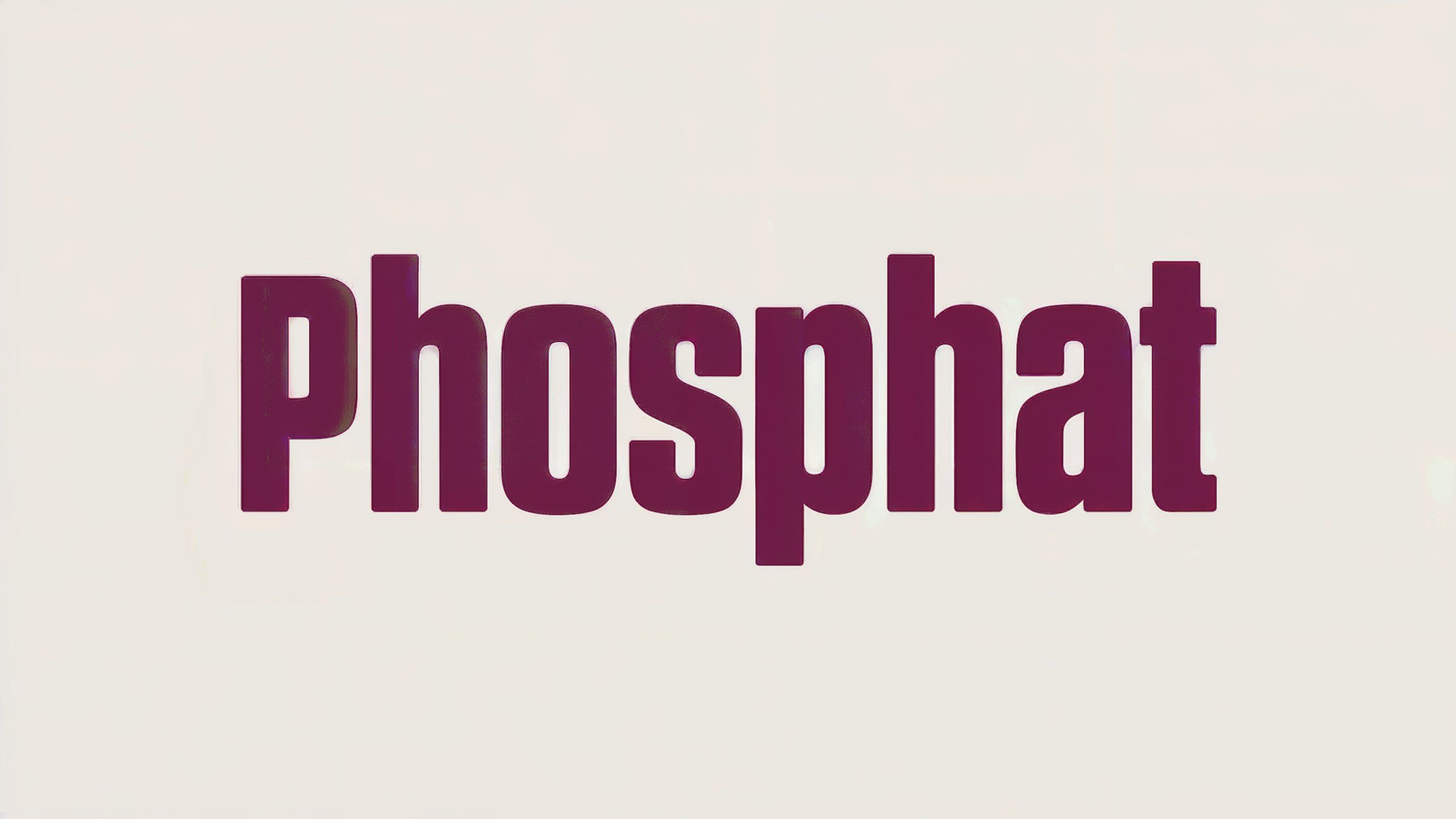Jeden Tag nehmen wir mit unserer Nahrung etwa 1000 bis 1500 Milligramm Phosphat auf - oft ohne es zu wissen. Dieser Mineralstoff steckt in fast allen Lebensmitteln und erfüllt lebenswichtige Aufgaben in jeder einzelnen unserer Körperzellen. Gleichzeitig warnen Gesundheitsexperten vor zu viel Phosphat in verarbeiteten Lebensmitteln. Ein Grund, genauer hinzuschauen: Was genau ist Phosphat, wo kommt es vor und wie viel brauchen wir wirklich?
Die Bedeutung von Phosphor für unseren Körper lässt sich kaum überschätzen. Nach Calcium ist es der zweithäufigste Mineralstoff im menschlichen Organismus. Ein erwachsener Mensch trägt etwa 600 bis 700 Gramm Phosphor in sich - das entspricht ungefähr dem Gewicht von sieben Tafeln Schokolade. Etwa 85 Prozent davon sind in Knochen und Zähnen eingelagert, der Rest verteilt sich auf alle Körperzellen [1]. Dort erfüllt Phosphat Aufgaben, ohne die Leben unmöglich wäre: Es speichert Energie, reguliert den Säure-Basen-Haushalt und ist Baustein unserer Erbsubstanz.
Phosphatfreie Cola
Chemische Grundlagen und Formen
Phosphor kommt in der Natur niemals in reiner Form vor - er ist zu reaktionsfreudig. Stattdessen finden wir ihn als Phosphat, also in Verbindung mit Sauerstoff. Die chemische Formel PO₄³⁻ beschreibt das Phosphat-Ion, das aus einem Phosphoratom und vier Sauerstoffatomen besteht. Diese negativ geladene Einheit verbindet sich mit positiv geladenen Partnern wie Calcium, Natrium oder Kalium zu verschiedenen Phosphatverbindungen.
Im menschlichen Körper liegt Phosphat hauptsächlich in drei Formen vor: Als anorganisches Phosphat im Blut und in den Zellen, als organisches Phosphat gebunden in Molekülen wie ATP (dem Energieträger der Zellen) und als Hydroxylapatit in Knochen und Zähnen. Die Konzentration von anorganischem Phosphat im Blutserum liegt normalerweise zwischen 0,84 und 1,45 Millimol pro Liter - ein Bereich, den der Körper sehr genau reguliert [2].
Besonders interessant ist die Rolle des pH-Werts für die verschiedenen Phosphatformen. Bei dem im Blut üblichen pH-Wert von 7,4 liegen etwa 80 Prozent als HPO₄²⁻ (Hydrogenphosphat) und 20 Prozent als H₂PO₄⁻ (Dihydrogenphosphat) vor. Diese beiden Formen bilden gemeinsam eines der wichtigsten Puffersysteme unseres Körpers - sie fangen Säuren und Basen ab und halten so den pH-Wert stabil [3].
Phosphatverbindungen in Lebensmitteln
In unserer Nahrung begegnet uns Phosphat in unterschiedlichsten Verbindungen. Natürliche Lebensmittel enthalten vor allem organische Phosphate - etwa Phospholipide in Eigelb und Fleisch oder Phytat in Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten. Die Lebensmittelindustrie setzt dagegen häufig anorganische Phosphate als Zusatzstoffe ein. Diese E-Nummern von E338 bis E343 sowie E450 bis E452 finden sich in vielen verarbeiteten Produkten.
Der entscheidende Unterschied: Während unser Körper organische Phosphate aus natürlichen Lebensmitteln zu etwa 40 bis 60 Prozent aufnimmt, werden anorganische Phosphatzusätze fast vollständig - zu etwa 90 Prozent - resorbiert [4]. Das macht einen großen Unterschied für unsere tägliche Phosphatbilanz.
Biologische Funktionen im Detail
Die Aufgaben von Phosphat in unserem Körper sind so vielfältig, dass ein Mangel praktisch jedes Organsystem beeinträchtigen würde. Schauen wir uns die wichtigsten Funktionen genauer an, um zu verstehen, warum dieser Mineralstoff unverzichtbar ist.
Der Energiestoffwechsel jeder einzelnen Zelle hängt von Phosphat ab. ATP (Adenosintriphosphat) ist die universelle Energiewährung unseres Körpers - ein Molekül, das aus Adenosin und drei Phosphatgruppen besteht. Wenn eine Zelle Energie braucht, spaltet sie eine Phosphatgruppe ab. Dabei wird Energie frei, die für alle möglichen Prozesse genutzt wird: Muskelkontraktion, Nervenleitung, Aufbau von Proteinen und vieles mehr. Pro Tag setzt ein erwachsener Mensch etwa sein eigenes Körpergewicht an ATP um - das zeigt, wie zentral diese Phosphatverbindung für unser Leben ist [5].
Nicht weniger wichtig ist Phosphat als Baustein unserer Erbsubstanz. Das Rückgrat der DNA und RNA besteht aus einer Kette von Zucker-Phosphat-Verbindungen. Ohne Phosphat keine Gene, keine Zellteilung, kein Leben. Auch die Zellmembranen bestehen zu einem großen Teil aus Phospholipiden - Fettmolekülen mit einer Phosphatgruppe. Diese besonderen Moleküle haben einen wasserliebenden Kopf (die Phosphatgruppe) und wasserabweisende Schwänze (die Fettsäuren). Diese Eigenschaft ermöglicht es ihnen, stabile Doppelschichten zu bilden, die das Innere der Zelle von der Umgebung trennen.
Knochen- und Zahngesundheit
Der größte Phosphatspeicher unseres Körpers sind die Knochen. Hier liegt Phosphat als Calciumphosphat vor, genauer gesagt als Hydroxylapatit mit der Formel Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂. Diese kristalline Verbindung macht etwa 70 Prozent der Knochenmasse aus und verleiht unseren Knochen ihre Festigkeit. Das Verhältnis von Calcium zu Phosphor im Knochen beträgt etwa 2:1 - eine Balance, die für die Knochenstabilität entscheidend ist [6].
Die Knochen sind aber nicht nur ein starres Gerüst, sondern ein dynamischer Phosphatspeicher. Bei Bedarf kann der Körper Phosphat aus den Knochen mobilisieren. Täglich werden etwa 200 Milligramm Phosphat zwischen Knochen und Blut ausgetauscht. Dieser ständige Umbau ermöglicht es, kurzfristige Schwankungen in der Phosphatversorgung auszugleichen.
Säure-Basen-Haushalt und Puffersysteme
Als Puffersubstanz hilft Phosphat, den pH-Wert unseres Blutes im engen Bereich zwischen 7,35 und 7,45 zu halten. Das Phosphatpuffersystem ist zwar mengenmäßig kleiner als das Bicarbonat-System, spielt aber besonders in den Zellen und im Urin eine wichtige Rolle. In den Nieren reguliert Phosphat die Ausscheidung von Säuren: Bei Übersäuerung bindet es Wasserstoffionen und wird als saures Phosphat ausgeschieden. So trägt es dazu bei, dass unser Körper trotz der ständigen Säureproduktion durch den Stoffwechsel nicht übersäuert [7].
Aufnahme und Stoffwechsel
Die Phosphataufnahme beginnt bereits im Mund, wo erste Phosphatverbindungen durch Enzyme aufgespalten werden. Der Hauptort der Absorption ist jedoch der Dünndarm, vor allem das Jejunum (mittlerer Dünndarmabschnitt). Hier arbeiten zwei Transportsysteme: Ein aktiver, Vitamin-D-abhängiger Transport, der bei niedrigen Phosphatkonzentrationen dominiert, und ein passiver Transport bei höheren Konzentrationen.
Der aktive Transport erfolgt über spezielle Transportproteine, die Natrium-Phosphat-Cotransporter genannt werden. Diese Proteine nutzen den Natriumgradienten über die Zellmembran, um Phosphat gegen sein Konzentrationsgefälle in die Darmzelle zu schleusen. Vitamin D (genauer: Calcitriol) steigert die Produktion dieser Transporter und erhöht so die Phosphataufnahme um bis zu 50 Prozent [8].
Nach der Aufnahme ins Blut verteilt sich Phosphat schnell im ganzen Körper. Die Konzentration im Blutplasma wird hauptsächlich durch drei Hormone reguliert: Parathormon aus den Nebenschilddrüsen, Calcitriol (die aktive Form von Vitamin D) und FGF-23 (Fibroblast Growth Factor 23) aus den Knochenzellen. Diese drei Botenstoffe arbeiten zusammen, um die Phosphataufnahme im Darm, die Rückresorption in den Nieren und die Freisetzung aus den Knochen zu steuern.
Regulation durch die Nieren
Die Nieren sind das zentrale Organ der Phosphatregulation. Sie filtern täglich etwa 6000 bis 7000 Milligramm Phosphat aus dem Blut, resorbieren aber normalerweise 80 bis 90 Prozent davon wieder zurück. Diese Rückresorption findet hauptsächlich im proximalen Tubulus statt und wird durch die gleichen Natrium-Phosphat-Cotransporter bewerkstelligt wie im Darm.
Wenn der Phosphatspiegel im Blut steigt, produzieren die Knochenzellen vermehrt FGF-23. Dieses Hormon hemmt die Rückresorption in den Nieren, sodass mehr Phosphat mit dem Urin ausgeschieden wird. Gleichzeitig reduziert es die Vitamin-D-Aktivierung und damit die Phosphataufnahme im Darm. So entsteht ein fein abgestimmtes Regelwerk, das die Phosphatkonzentration im Blut konstant hält [9].
Vorkommen in Lebensmitteln
Phosphat findet sich in praktisch allen Lebensmitteln, allerdings in sehr unterschiedlichen Mengen und Formen. Für eine ausgewogene Ernährung ist es wichtig zu wissen, welche Lebensmittel besonders phosphatreich sind und wie gut der Körper das enthaltene Phosphat verwerten kann.
Tierische Lebensmittel sind generell reich an gut verfügbarem Phosphat. Besonders hohe Gehalte finden sich in Hartkäse, Schmelzkäse, Eigelb und Innereien. Aber auch Fleisch, Fisch und Milchprodukte liefern beträchtliche Mengen. Das Phosphat aus tierischen Quellen wird zu etwa 60 bis 70 Prozent vom Körper aufgenommen, da es hauptsächlich in Form von Phosphoproteinen und Phospholipiden vorliegt, die gut verdaulich sind [10].
| Lebensmittel | Phosphatgehalt (mg/100g) | Bioverfügbarkeit (%) |
|---|---|---|
| Schmelzkäse | 800-1000 | 90-95 |
| Parmesan | 730 | 60-70 |
| Weizenkeime | 1100 | 40-50 |
| Sojabohnen | 550 | 30-40 |
| Leber (Schwein) | 360 | 70-80 |
| Lachs | 280 | 60-70 |
| Hühnerei | 200 | 70-80 |
| Vollmilch | 92 | 60-70 |
| Kartoffeln | 50 | 70-80 |
Pflanzliche Lebensmittel enthalten oft beachtliche Mengen an Phosphat, allerdings in einer Form, die schwerer verwertbar ist. In Getreide, Hülsenfrüchten und Nüssen liegt ein Großteil des Phosphats als Phytat (Phytinsäure) vor. Diese Verbindung kann der menschliche Körper nur schlecht aufspalten, da uns das Enzym Phytase fehlt. Die Bioverfügbarkeit von Phosphat aus phytatreichen Lebensmitteln liegt deshalb nur bei 30 bis 50 Prozent. Durch Keimen, Fermentation oder Sauerteigführung lässt sich der Phytatgehalt reduzieren und die Phosphatverfügbarkeit verbessern [11].
Phosphatzusätze in verarbeiteten Lebensmitteln
Ein kritischer Punkt in der modernen Ernährung sind die Phosphatzusätze in verarbeiteten Lebensmitteln. Diese anorganischen Phosphate werden als Säureregulatoren, Emulgatoren, Schmelzsalze oder Konservierungsmittel eingesetzt. Man findet sie in Cola-Getränken (Phosphorsäure E338), Wurstwaren, Schmelzkäse, Backwaren und vielen Fertiggerichten.
Das Problem: Diese Zusätze werden zu etwa 90 bis 95 Prozent absorbiert - deutlich mehr als natürliche Phosphatquellen. Eine Dose Cola (330 ml) enthält etwa 40 bis 70 Milligramm zugesetztes Phosphat, das fast vollständig aufgenommen wird. Bei regelmäßigem Konsum stark verarbeiteter Lebensmittel kann die tägliche Phosphataufnahme leicht um 500 bis 1000 Milligramm über dem Bedarf liegen [12].
Erschwerend kommt hinzu, dass Phosphatzusätze auf Lebensmittelverpackungen nicht mengenmäßig deklariert werden müssen. Sie verstecken sich hinter E-Nummern in der Zutatenliste, ohne dass Verbraucher erkennen können, wie viel zusätzliches Phosphat sie aufnehmen. Studien zeigen, dass der tatsächliche Phosphatgehalt von Fertigprodukten oft doppelt so hoch ist wie in Nährwerttabellen angegeben, die nur das natürlich vorkommende Phosphat berücksichtigen.
Tagesbedarf und Empfehlungen
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt für Erwachsene eine tägliche Phosphatzufuhr von 700 Milligramm. Kinder und Jugendliche im Wachstum haben einen höheren Bedarf: 500 Milligramm für 1- bis 4-Jährige, steigernd bis auf 1250 Milligramm für 13- bis 19-Jährige. Schwangere benötigen 800 Milligramm, Stillende 900 Milligramm täglich [13].
Diese Empfehlungen basieren auf dem Phosphatbedarf für den Aufbau und Erhalt von Knochen und Zähnen sowie für alle Stoffwechselfunktionen. Wichtig ist dabei das Verhältnis von Calcium zu Phosphat in der Nahrung, das idealerweise bei etwa 1:1 bis 1,5:1 liegen sollte. In der typischen westlichen Ernährung verschiebt sich dieses Verhältnis jedoch oft zugunsten von Phosphat auf 1:1,5 bis 1:2.
Die tatsächliche Phosphataufnahme liegt in Deutschland deutlich über den Empfehlungen. Männer nehmen durchschnittlich 1400 bis 1600 Milligramm täglich auf, Frauen 1000 bis 1200 Milligramm. Besonders junge Männer zwischen 15 und 25 Jahren erreichen durch den hohen Konsum von Fast Food, Fleisch und Softdrinks oft Werte über 2000 Milligramm pro Tag [14].
Risikogruppen für Phosphatmangel
Obwohl die meisten Menschen eher zu viel als zu wenig Phosphat aufnehmen, gibt es Gruppen mit erhöhtem Risiko für einen Mangel:
- Frühgeborene haben noch keine ausreichenden Phosphatspeicher aufgebaut und brauchen für ihr schnelles Wachstum extra viel von diesem Mineralstoff
- Menschen mit chronischen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Zöliakie können Phosphat schlechter aufnehmen
- Alkoholkranke haben oft eine Mangelernährung und zusätzlich erhöhte Phosphatverluste über die Nieren
- Patienten, die dauerhaft Antazida (Säureblocker mit Aluminium) einnehmen - das Aluminium bindet Phosphat im Darm und verhindert die Aufnahme
- Menschen mit bestimmten genetischen Störungen des Phosphatstoffwechsels
Gesundheitliche Auswirkungen
Sowohl zu wenig als auch zu viel Phosphat kann gesundheitliche Probleme verursachen. Die Auswirkungen reichen von akuten Beschwerden bis zu chronischen Erkrankungen, wobei in unserer Gesellschaft die Probleme durch Überversorgung deutlich häufiger sind als Mangelerscheinungen.
Ein Phosphatmangel (Hypophosphatämie) mit Serumwerten unter 0,8 Millimol pro Liter ist in entwickelten Ländern selten. Wenn er auftritt, macht er sich zunächst durch Muskelschwäche, Müdigkeit und Appetitlosigkeit bemerkbar. Bei schwerem Mangel können Verwirrtheit, Koordinationsstörungen und sogar Krampfanfälle auftreten. Die roten Blutkörperchen verlieren ihre Flexibilität, was zu Blutarmut führen kann. Langfristig leidet die Knochenmineralisierung - es entwickeln sich Osteomalazie bei Erwachsenen oder Rachitis bei Kindern [15].
Folgen einer Phosphatüberversorgung
Wesentlich relevanter für unsere Gesundheit ist heute die chronische Phosphatüberversorgung. Hohe Phosphatspiegel im Blut (über 1,45 Millimol pro Liter) schädigen die Blutgefäße auf mehreren Wegen. Phosphat fördert die Verkalkung der Gefäßwände, indem es glatte Muskelzellen in den Arterien zu knochenähnlichen Zellen umprogrammiert. Diese beginnen dann, Calcium einzulagern - die Gefäße werden steif und verlieren ihre Elastizität.
Studien zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen erhöhten Phosphatspiegeln und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine große Untersuchung mit über 4000 Teilnehmern fand heraus, dass Menschen mit Phosphatwerten im oberen Normalbereich ein um 55 Prozent höheres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall hatten als jene mit niedrig-normalen Werten. Dieser Zusammenhang bestand unabhängig von anderen Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder Diabetes [16].
Besonders gefährdet sind Nierenkranke. Ihre Nieren können überschüssiges Phosphat nicht mehr ausreichend ausscheiden, wodurch der Spiegel im Blut steigt. Dies führt zu einer gefährlichen Kettenreaktion: Das hohe Phosphat stimuliert die Nebenschilddrüsen zur vermehrten Parathormon-Produktion. Dieses Hormon mobilisiert Calcium aus den Knochen, um das Calcium-Phosphat-Verhältnis im Blut auszugleichen. Die Folge: Die Knochen werden brüchig (renale Osteodystrophie), während sich Calcium-Phosphat-Kristalle in Weichteilen und Gefäßen ablagern.
Wechselwirkungen mit anderen Nährstoffen
Phosphat steht in enger Wechselwirkung mit anderen Mineralstoffen, besonders mit Calcium, Magnesium und Eisen. Ein Übermaß an Phosphat kann die Aufnahme dieser Mineralstoffe beeinträchtigen und zu sekundären Mangelzuständen führen.
Die Calcium-Phosphat-Balance ist besonders kritisch. Bei zu hoher Phosphatzufuhr und gleichzeitig niedriger Calciumaufnahme - typisch für eine Fast-Food-lastige Ernährung - wird vermehrt Parathormon ausgeschüttet. Dies mobilisiert Calcium aus den Knochen, um das Verhältnis im Blut konstant zu halten. Langfristig kann dies die Knochendichte verringern und das Osteoporose-Risiko erhöhen [17].
Auch mit Eisen konkurriert Phosphat um die Aufnahme im Darm. Hohe Phosphatmengen können die Eisenresorption um bis zu 40 Prozent reduzieren. Dies ist besonders problematisch bei Menschen, die ohnehin zu Eisenmangel neigen, etwa Vegetarier oder Frauen mit starken Menstruationsblutungen.
| Wechselwirkung | Effekt bei hoher Phosphatzufuhr | Klinische Bedeutung |
|---|---|---|
| Calcium | Verminderte Absorption, erhöhte Knochenmobilisation | Osteoporose-Risiko erhöht |
| Magnesium | Bildung unlöslicher Komplexe, reduzierte Aufnahme | Muskelkrämpfe, Herzrhythmusstörungen möglich |
| Eisen | Um 30-40% verminderte Resorption | Eisenmangel, Anämie-Risiko |
| Zink | Komplexbildung, schlechtere Verfügbarkeit | Immunschwäche, Wundheilungsstörungen |
| Vitamin D | Suppression der Aktivierung zu Calcitriol | Gestörte Calcium-Homöostase |
Phosphat bei speziellen Erkrankungen
Bei verschiedenen Krankheiten spielt der Phosphatstoffwechsel eine besondere Rolle. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ist wichtig für Betroffene und kann helfen, durch angepasste Ernährung den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen.
Chronische Nierenerkrankung
Für die etwa 2 Millionen Nierenkranken in Deutschland ist die Phosphatkontrolle überlebenswichtig. Bereits im Stadium 3 der chronischen Nierenerkrankung (Kreatinin-Clearance 30-59 ml/min) beginnen Phosphatretention und sekundärer Hyperparathyreoidismus. Die Patienten sollten ihre Phosphatzufuhr auf 800 bis 1000 Milligramm täglich begrenzen - eine Herausforderung angesichts des hohen Phosphatgehalts vieler Lebensmittel [18].
Dialysepatienten haben es noch schwerer. Die Dialyse entfernt nur etwa 800 bis 1000 Milligramm Phosphat pro Sitzung, während mit der Nahrung oft mehr aufgenommen wird. Deshalb müssen viele Dialysepatienten Phosphatbinder zu den Mahlzeiten einnehmen. Diese Medikamente - früher Aluminium-haltig, heute meist Calcium-, Lanthan- oder Eisenverbindungen - binden Phosphat im Darm und verhindern seine Aufnahme.
Die Ernährungsberatung für Nierenkranke ist komplex: Einerseits sollen sie proteinreich essen, um Muskelschwund vorzubeugen, andererseits sind proteinreiche Lebensmittel oft auch phosphatreich. Die Lösung liegt in der geschickten Auswahl: Eiweiß aus Eiern hat ein besseres Phosphat-Protein-Verhältnis als Fleisch. Pflanzliche Proteine enthalten zwar viel Phosphat, aber in der schlechter verfügbaren Phytat-Form.
Diabetes mellitus
Bei Diabetikern besteht eine komplexe Beziehung zum Phosphatstoffwechsel. Einerseits haben schlecht eingestellte Diabetiker oft niedrige Phosphatspiegel, da die osmotische Diurese bei hohen Blutzuckerwerten zu Phosphatverlusten über die Nieren führt. Andererseits entwickeln viele Diabetiker im Verlauf eine Nierenschädigung (diabetische Nephropathie), die dann zu erhöhten Phosphatspiegeln führt.
Neue Forschungen zeigen, dass hohe Phosphatspiegel die Insulinresistenz verstärken können. FGF-23, das bei hoher Phosphatzufuhr vermehrt gebildet wird, interferiert mit der Insulinsignalübertragung. Eine Studie mit 1200 Teilnehmern fand eine Korrelation zwischen hohen Phosphatspiegeln und dem Risiko, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln [19].
Osteoporose
Bei Osteoporose ist nicht nur die Calciumversorgung wichtig, sondern auch das richtige Verhältnis von Calcium zu Phosphat. Eine phosphatreiche Ernährung bei gleichzeitig niedriger Calciumzufuhr beschleunigt den Knochenabbau. Dies geschieht über die Stimulation der Parathormon-Sekretion, die Calcium aus den Knochen mobilisiert.
Besonders problematisch sind phosphorsäurehaltige Softdrinks. Studien zeigen, dass Frauen, die täglich Cola trinken, eine um 4 Prozent niedrigere Knochendichte in der Hüfte haben als Frauen, die keine Cola konsumieren. Der Effekt war unabhängig von der Calciumzufuhr und anderen Risikofaktoren [20].
Empfehlungen für eine ausgewogene Phosphatzufuhr
Eine phosphatbewusste Ernährung bedeutet nicht, auf phosphathaltige Lebensmittel zu verzichten - das wäre weder möglich noch sinnvoll. Vielmehr geht es darum, die richtigen Phosphatquellen zu wählen und das Verhältnis zu anderen Mineralstoffen im Blick zu behalten.
Der erste Schritt ist die Reduktion von Lebensmitteln mit Phosphatzusätzen. Dies bedeutet konkret: Weniger Fertigprodukte, Fast Food und Softdrinks. Stattdessen mehr frische, unverarbeitete Lebensmittel. Beim Einkaufen hilft ein Blick auf die Zutatenliste: E-Nummern von E338 bis E343 sowie E450 bis E452 weisen auf zugesetzte Phosphate hin.
Bei der Lebensmittelauswahl sollte das Phosphat-Protein-Verhältnis beachtet werden. Günstig sind Lebensmittel, die viel hochwertiges Protein bei moderatem Phosphatgehalt liefern. Eier haben mit etwa 10 Milligramm Phosphat pro Gramm Protein ein exzellentes Verhältnis. Auch Milch und Joghurt schneiden mit 11 bis 12 Milligramm pro Gramm Protein gut ab. Ungünstiger sind verarbeitete Fleischprodukte und besonders Schmelzkäse mit über 20 Milligramm Phosphat pro Gramm Protein.
Tipps für die Küchenpraxis
Durch die richtige Zubereitung lässt sich der Phosphatgehalt von Lebensmitteln beeinflussen. Beim Kochen geht ein Teil des Phosphats ins Kochwasser über - etwa 20 bis 30 Prozent bei Kartoffeln und Gemüse. Wer phosphatarm essen muss, sollte das Kochwasser wegschütten statt es für Suppen zu verwenden.
Bei Hülsenfrüchten und Getreide kann das Einweichen und Keimen den Phytatgehalt reduzieren und gleichzeitig die Verfügbarkeit von Phosphat und anderen Mineralstoffen verbessern. Zwölf Stunden Einweichen reduziert den Phytatgehalt um etwa 20 Prozent, Keimen über 48 Stunden sogar um bis zu 60 Prozent.
Für die Calciumversorgung sollten calciumreiche, phosphatarme Lebensmittel bewusst in den Speiseplan eingebaut werden. Grünes Blattgemüse wie Grünkohl (210 mg Calcium, 90 mg Phosphat pro 100g) oder mit Calcium angereicherter Tofu sind gute Optionen. Auch calciumreiches Mineralwasser (über 150 mg/L) hilft, das Calcium-Phosphat-Verhältnis zu verbessern.
Supplementierung - wann sinnvoll?
Phosphat-Nahrungsergänzungsmittel sind für die allermeisten Menschen überflüssig und potenziell schädlich. Nur in seltenen Fällen - etwa bei bestimmten genetischen Störungen oder schwerer Mangelernährung - kann eine Supplementierung unter ärztlicher Aufsicht sinnvoll sein.
Anders sieht es mit Phosphatbindern aus, die bei Nierenkranken die Phosphataufnahme reduzieren sollen. Diese verschreibungspflichtigen Medikamente müssen individuell dosiert und regelmäßig kontrolliert werden. Calciumhaltige Binder sollten maximal 1500 Milligramm elementares Calcium pro Tag liefern, um Gefäßverkalkungen zu vermeiden.
Aktuelle Forschung und Zukunftsperspektiven
Die Phosphatforschung hat in den letzten Jahren wichtige neue Erkenntnisse gebracht. Besonders die Entdeckung von FGF-23 und Klotho als zentrale Regulatoren des Phosphatstoffwechsels hat unser Verständnis revolutioniert. FGF-23 wird nicht nur bei hoher Phosphatzufuhr vermehrt gebildet, sondern steigt auch bei Nierenerkrankungen, Herzinsuffizienz und chronischen Entzündungen an. Erhöhte FGF-23-Spiegel sind mit einem erhöhten Sterberisiko assoziiert - unabhängig von der Nierenfunktion [21].
Klotho, der Co-Rezeptor für FGF-23, hat sich als Anti-Aging-Protein entpuppt. Mäuse mit Klotho-Mangel altern vorzeitig und entwickeln Gefäßverkalkungen, Osteoporose und Muskelschwund - alles Symptome, die auch bei chronischer Phosphatüberladung auftreten. Die Klotho-Expression nimmt mit dem Alter und bei Nierenerkrankungen ab, was die Phosphattoxizität verstärkt.
Ein neues Forschungsfeld ist die Rolle von Phosphat bei Krebserkrankungen. Tumorzellen haben einen erhöhten Phosphatbedarf für ihr schnelles Wachstum und die gesteigerte Proteinsynthese. Erste Studien zeigen, dass eine phosphatreduzierte Diät das Tumorwachstum bei Mäusen verlangsamen kann. Ob dies therapeutisch beim Menschen nutzbar ist, wird derzeit untersucht.
Neue therapeutische Ansätze
In der Entwicklung sind neue Phosphatbinder, die spezifischer und nebenwirkungsärmer sein sollen als die bisherigen. Tenapanor, ein Inhibitor des Natrium-Wasserstoff-Austauschers NHE3, reduziert die Phosphataufnahme im Darm ohne selbst absorbiert zu werden. Erste klinische Studien zeigen eine Senkung der Phosphatspiegel um 20 bis 30 Prozent.
Ein anderer Ansatz zielt auf die Hemmung der Natrium-Phosphat-Cotransporter. Niacin (Vitamin B3) und verwandte Substanzen können diese Transporter blockieren und so die Phosphataufnahme reduzieren. Allerdings sind die benötigten Dosen hoch und mit Nebenwirkungen wie Flush-Symptomen verbunden.
Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass eine personalisierte Phosphattherapie möglich werden könnte. Genetische Varianten in Phosphattransportern und Regulatorproteinen beeinflussen, wie Menschen auf Phosphat reagieren. Manche haben von Natur aus höhere oder niedrigere Phosphatspiegel. Diese individuellen Unterschiede könnten künftig bei Ernährungsempfehlungen berücksichtigt werden.
Fazit
Phosphat ist ein essentieller Mineralstoff mit vielfältigen Funktionen in unserem Körper - von der Energiespeicherung über die Knochengesundheit bis zur Regulation des Säure-Basen-Haushalts. Während ein echter Phosphatmangel in entwickelten Ländern selten ist, stellt die schleichende Überversorgung durch phosphatreiche Ernährung und vor allem durch Phosphatzusätze in verarbeiteten Lebensmitteln ein unterschätztes Gesundheitsrisiko dar.
Die wissenschaftliche Evidenz zeigt klar: Chronisch erhöhte Phosphatspiegel beschleunigen die Gefäßalterung, erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und können die Nierenfunktion beeinträchtigen. Besonders gefährdet sind Menschen mit vorbestehenden Nierenerkrankungen, Diabetes oder Osteoporose. Aber auch Gesunde profitieren von einer phosphatbewussten Ernährung.
Die praktische Umsetzung ist gar nicht so schwer: Weniger Fertigprodukte und Fast Food, dafür mehr frische, unverarbeitete Lebensmittel. Ein Blick auf die Zutatenliste hilft, versteckte Phosphatzusätze zu erkennen. Wichtig ist auch das richtige Verhältnis von Calcium zu Phosphat - idealerweise sollten wir mindestens genauso viel Calcium wie Phosphat aufnehmen.
Die Forschung der letzten Jahre hat unser Verständnis des Phosphatstoffwechsels erheblich erweitert. Die Entdeckung von FGF-23 und Klotho als zentrale Regulatoren eröffnet neue therapeutische Möglichkeiten. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass Phosphat nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern im Kontext des gesamten Mineralstoffhaushalts gesehen werden muss.
Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass individualisierte Ernährungsempfehlungen basierend auf genetischen Faktoren und Biomarkern möglich werden könnten. Bis dahin gilt: Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung mit viel frischem Gemüse, moderaten Mengen tierischer Produkte und wenig verarbeiteten Lebensmitteln ist der beste Weg zu einer optimalen Phosphatversorgung. Die alte Ernährungsweisheit "So natürlich wie möglich" bewährt sich auch beim Thema Phosphat.
📚 Quellen (21 Quellen)
Quellen
- Takeda E, Yamamoto H, Yamanaka-Okumura H, Taketani Y. Dietary phosphorus in bone health and quality of life. Nutr Rev. 2012;70(6):311-321.
- Block GA, Hulbert-Shearon TE, Levin NW, Port FK. Association of serum phosphorus and calcium x phosphate product with mortality risk in chronic hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 1998;31(4):607-617.
- Bergwitz C, Jüppner H. Regulation of phosphate homeostasis by PTH, vitamin D, and FGF23. Annu Rev Med. 2010;61:91-104.
- Calvo MS, Uribarri J. Contributions to total phosphorus intake: all sources considered. Semin Dial. 2013;26(1):54-61.
- Brosnan JT, Brosnan ME. The role of dietary creatine. Amino Acids. 2016;48(8):1785-1791.
- Penido MG, Alon US. Phosphate homeostasis and its role in bone health. Pediatr Nephrol. 2012;27(11):2039-2048.
- Hamm LL, Simon EE. Roles and mechanisms of urinary buffer excretion. Am J Physiol. 1987;253(4):F595-F605.
- Marks J, Srai SK, Biber J, Murer H, Unwin RJ, Debnam ES. Intestinal phosphate absorption and the effect of vitamin D. J Steroid Biochem Mol Biol. 2006;103(3-5):497-503.
- Wolf M. Update on fibroblast growth factor 23 in chronic kidney disease. Kidney Int. 2012;82(7):737-747.
- Kalantar-Zadeh K, Gutekunst L, Mehrotra R, et al. Understanding sources of dietary phosphorus in the treatment of patients with chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5(3):519-530.
- Lopez HW, Leenhardt F, Coudray C, Remesy C. Minerals and phytic acid interactions. Int J Food Sci Tech. 2002;37(7):727-739.
- Sullivan CM, Leon JB, Sehgal AR. Phosphorus-containing food additives and the accuracy of nutrient databases. J Ren Nutr. 2007;17(5):350-354.
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. 2. Auflage. Bonn: DGE; 2019.
- Max Rubner-Institut. Nationale Verzehrsstudie II. Karlsruhe: MRI; 2008.
- Amanzadeh J, Reilly RF Jr. Hypophosphatemia: an evidence-based approach to its clinical consequences. Nephrol Dial Transplant. 2006;21(2):316-322.
- Dhingra R, Sullivan LM, Fox CS, et al. Relations of serum phosphorus and calcium levels to the incidence of cardiovascular disease. Arch Intern Med. 2007;167(9):879-885.
- Karp HJ, Vaihia KP, Kärkkäinen MU, Niemistö MJ, Lamberg-Allardt CJ. Acute effects of different phosphorus sources on calcium and bone metabolism in young women. Br J Nutr. 2007;98(2):398-405.
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney disease-mineral and bone disorder. Kidney Int Suppl. 2009;(113):S1-S130.
- Fiorentino M, Landais E, Ndiaye B, et al. Elevated phosphorus may contribute to metabolic disorders in patients with and without chronic kidney disease. J Clin Endocrinol Metab. 2021;106(8):e3290-e3302.
- Tucker KL, Morita K, Qiao N, Hannan MT, Cupples LA, Kiel DP. Colas, but not other carbonated beverages, are associated with low bone mineral density in older women. Am J Clin Nutr. 2006;84(4):936-942.
- Gutiérrez OM, Mannstadt M, Isakova T, et al. Fibroblast growth factor 23 and mortality among patients undergoing hemodialysis. N Engl J Med. 2008;359(6):584-592.